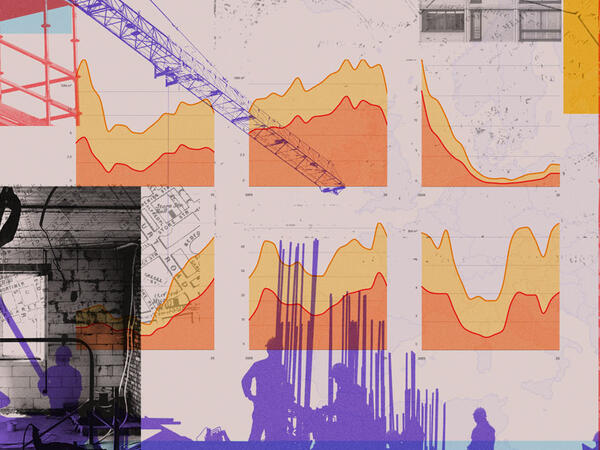Frau Kurz beschließt zu sterben
Mehrere Hundert Deutsche wählten im vergangenen Jahr den assistierten Suizid. Die Schauspielerin Eva-Maria Kurz war eine von ihnen. Wie kann ein Mensch so etwas entscheiden? Protokoll eines Jahres zwischen Bleiben und Gehen.
Sie beherrscht die Kunst zu verschwinden. Kann sich stumm aus Gesprächen ziehen, in einem Raum voller Menschen plötzlich so teilnahmslos sein, dass sie nahezu unsichtbar wirkt. In Gedanken längst geflüchtet, weil ihr alles zu viel wird, zu banal, zu blöd.
Aber jetzt sitzt sie hier und weiß nicht mehr: Wie geht das, dieses Verschwinden?
Eva-Maria Kurz weint. Sie hat ihren zarten Körper auf dem Stuhl in ihrem Arbeitszimmer zusammengefaltet, die Beine eng aneinandergedrückt, den Rücken gerundet, kraftlos. 40 Kilogramm wiegt sie noch, ist barfuß wie immer.
Es ist ein Tag im Mai 2023, der Monat, in dem sie 79 Jahre alt wird. Wenige Stunden zuvor hat sie am Esstisch in ihrem Wohnzimmer einen Zettel mit ihren aktuellen Blutwerten in den Händen gehalten. Die seien gut, haben die Ärzte ihr gesagt. Das ist ihr Anlass zur Freude und zu großem Unverständnis: Wie kann denn gut sein, was sich überhaupt nicht gut anfühlt?
Zu diesem Zeitpunkt hat Eva-Maria Kurz längst entschieden zu sterben.