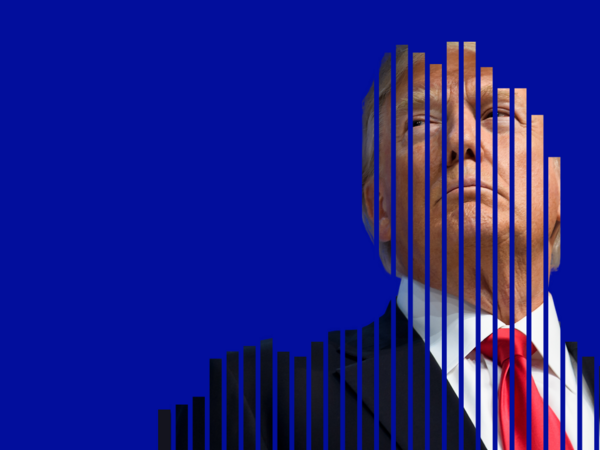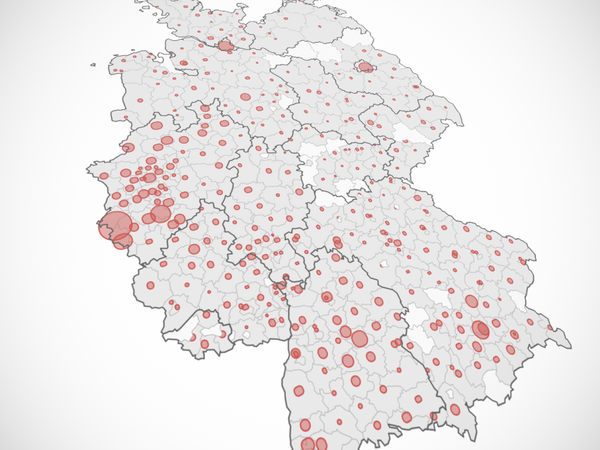US-Wahl 2024: Swing States, Kandidaten, Daten
Seit mehr als 200 Jahren sind die USA bereits eine Demokratie, so lange wie kaum ein anderes Land auf der Welt. In früheren Wahlkämpfen wurde die demokratische Tradition ausgiebig zur Schau getragen, die uralten Rituale des Wahlsystems stolz zelebriert. Doch nicht zum ersten Mal stellt Donald Trump die Grundregeln des Prozesses infrage. Ob er ein Wahlergebnis, das zu seinen Ungunsten ausfallen würde, akzeptieren würde, ist auch in diesem Jahr mehr als fraglich.
Nicht nur deshalb bereiten sich die Vereinigten Staaten auf unruhige Wochen nach der Wahl am 5. November vor. Wie schon bei vergangenen Abstimmungen dürfte es auch dieses Mal wieder äußerst knapp werden. Mit einem Ergebnis wird erst nach dem eigentlichen Abstimmungstag gerechnet. Beobachter gehen davon aus, dass es eine Reihe von Klagen gegen Auszählungen in einzelnen Bundesstaaten geben wird.
So schwerwiegend die Folgen des politischen Chaos nach der Wahl werden könnten, so schwierig ist es, einen Überblick zu behalten. Wir geben deshalb in kompakter Form Antworten auf die 20 wichtigsten Fragen in diesem Wahlkampf.
Durch Klick auf einzelne Gliederungspunkte gelangen Sie direkt zur jeweiligen Antwort:
1. Wie wird man Präsident?
Der Wahlkampf läuft schon, seitdem die beiden großen Parteien ihre Kandidaten von Januar bis Juni dieses Jahres kürten. In einem mehrstufigen Verfahren, den „Primaries“, also den Vorwahlen, traten Politikerinnen und Politiker der Republikaner und der Demokraten im Ringen um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten gegeneinander an – auch wenn im Prinzip zunächst ziemlich klar war, dass Joe Biden und Donald Trump für ihre Parteien antreten würden. Bekanntermaßen zog sich Biden allerdings Ende Juli als amtierender Präsident wegen des enormen Drucks seiner Partei zurück. Seine „Vize“ Kamala Harris stieg dafür ins Rennen ein.
Auf den Parteitagen im Sommer wurden schließlich Trump für die Republikaner und Harris für die Demokraten als Präsidentschaftskandidaten bestätigt.
Die Wahl am 5. November für sich entscheiden kann der- oder diejenige, der oder die die Mehrheit im Gremium der Wahlmänner und -frauen gewinnt. Eigentlich wird also am Wahltag nicht direkt der Präsident gewählt, sondern die Zusammensetzung des „electoral college“ bestimmt. Wie genau das System funktioniert, finden Sie in unserem ausführlichen Erklärartikel zum US-Wahlsystem:
Das „electoral college“ umfasst 538 Personen. Das Gremium tritt nur zusammen, um den Präsidenten zu bestimmen. Je nach Bevölkerungsdichte entsenden die Bundesstaaten unterschiedlich große Gruppen ins „electoral college“, Kalifornien entsendet mit 55 Personen die meisten; viele dünner besiedelte, ländlich geprägte oder kleine Staaten nur drei. Der Präsidentschaftskandidat, der einen Bundesstaat gewinnt, erhält nach dem „Winner takes all“-Prinzip jeweils die Stimmen aller Wahlleute, die ein Bundesstaat entsendet. Bei 270 Wahlleuten ist die Mehrheit erreicht. Das System der Wahlleute ist übrigens ein Kompromiss. Die Mitglieder des Verfassungskonvent im Jahr 1787 konnten sich nicht einigen, ob das Volk das Staatsoberhaupt direkt wählen sollte oder ob dem Parlament diese Aufgabe zusteht.
Dieses Mehrheitswahlrecht hat zur Folge, dass nicht immer der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen gewinnt. Hillary Clinton zum Beispiel gewann 2016 in bevölkerungsreichen Staaten, sie verlor in zahlreichen Staaten aber auch ganz knapp gegen Donald Trump. In diesen knappen Staaten bekam Trump dann alle Stimmen der Wahlleute. Das System steht deshalb schon lange in der Kritik. Zwei Staaten machen es deshalb anders: In Maine und Nebraska werden die Stimmen der Wahlleute proportional nach den erlangten Wählerstimmen aufgeteilt.
2. Wer sind die Wahlmänner und -frauen?

Artikel 2 der amerikanischen Verfassung besagt, dass jeder Bundesstaat selbst bestimmen kann, in welchem Verfahren er seine Wahlmänner benennt. Demokraten und Republikaner in jedem Bundesstaat entscheiden schon im Sommer vor der Wahl auf Landesparteitagen oder in eigenen Parteigremien, wen sie zu Wahlleuten ernennen. In manchen Staaten gibt es noch einmal Vorwahlen, in anderen werden die Wahlleute einfach von den Parteigremien bestimmt.
Jede Partei ernennt so viele Wahlleute, wie es maximal in dem Staat zu gewinnen gibt. Im Falle eines Sieges geben dann alle Wahlleute ihre Stimme für ihren Präsidentschaftskandidaten ab. In Einzelfällen ist es schon dazu gekommen, dass Wahlleute nicht für den Kandidaten der Partei gestimmt haben, von der sie nominiert worden sind – das ist aber selten und hat noch nie eine Wahl entschieden.
3. Welche Staaten sind bei dieser Wahl besonders wichtig?
Von den 50 Staaten (plus Washington D.C., das nicht als Staat zählt, aber drei Wahlleute stellt) sind mindestens 35 fest in der Hand einer Partei. Nur rund 15 wechseln gelegentlich das Lager und gelten deshalb als „Battleground States“ oder „Swing States“ – Staaten, die von Wahl zu Wahl die Farbe wechseln und deshalb besonders umkämpft sind.
Florida, Pennsylvania, Michigan, Ohio, Wisconsin und North Carolina gelten als klassische „Swing States“. Bei der vergangenen Wahl kam noch Arizona mit hinzu. In diesem Staat zeigen sich Veränderungen in der Sozialstruktur der USA insgesamt jetzt schon besonders: Hier leben besonders viele Menschen mit lateinamerikanischem Migrationshintergrund (Amerikanisch: Hispanics). Diese Gruppe wächst – und wählt eher demokratisch, weshalb der ehemals fest republikanische Wüstenstaat nun „blau“ werden könnte, also demokratisch. Dasselbe gilt, wenn auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit, für Texas.
Interessant sind vor allem die „blue wall“-Staaten, die blaue Wand im nördlichen mittleren Westen: Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Diese galten in der Vergangenheit als klassisch demokratisch wählende Staaten. Die Demokraten sind in diesen Wochen jedoch besorgt, dass ein oder mehreren von ihnen am 5. November an Trump fallen könnten. Auch deshalb legt Harris auf diese Staaten einen Fokus im Wahlkampf.
4. Gibt es neben Trump und Harris noch andere Kandidaten und welche Rolle spielen sie?
Ja, es gibt einige sogenannte „third party candidates“, die im Prinzip komplett chancenlos sind. Aber: Sie können den Kandidaten der großen Parteien empfindliche Schläge versetzen, indem sie Stimmen für sich gewinnen.
In diesem Jahr treten neben den beiden Hauptkandidaten Trump und Harris zum Beispiel Jill Stein für die Grüne Partei, der Aktivist Cornel West als Unabhängiger und der Libertäre Chase Oliver an. Auch der umstrittene Robert F. Kennedy jr. steht in einigen Staaten noch auf dem Wahlzettel, obwohl er schon offiziell aus dem Rennen ausgeschieden ist.
Die Bedeutung der chancenlosen Drittkandidaten zeigt sich an einer Episode nach der vorletzten Wahl 2016, bei der es eine Diskussion um Jill Steins Rolle gab. Es wurde gemutmaßt, dass sie der damaligen Kandidatin Clinton wichtige Stimmen gekostet und so für Trumps Wahlsieg gesorgt habe. In Pennsylvania hatte Stein einige Tausend Stimmen geholt, Clinton verlor diesen Swing State knapp. Kandidaten von Drittparteien können also das Wahlergebnis beeinflussen.
5. Warum wird am 5. November gewählt?
Der Wahltermin ist in der Verfassung festgelegt: Am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November wählen die Amerikaner traditionell ihren Präsidenten – seit 175 Jahren. Der Kongress hatte 1845 diesen Termin für die Wahl der Wahlmänner der damals aus 28 Bundesstaaten bestehenden Vereinigten Staaten bestimmt.
Zuvor hatten die Staaten eine gewisse Flexibilität bei der Festlegung ihres Wahltermins. Mit dem Ausbau der Infrastruktur wuchs die Sorge, dass die Ergebnisse in einem Staat die eines anderen beeinflussen könnten. Also sollte einheitlich gewählt werden. Der November wurde ausgesucht, weil die Farmer dann bereits ihre Ernte eingeholt hatten, der harte Winter, der Wähler davon abhalten könnte, sich zu ihrem Wahllokal aufzumachen, in der Regel aber noch bevorstand. Dass an einem Werktag gewählt wird, unterscheidet die USA von den meisten anderen Ländern. Die Gesetzgeber nahmen damals Rücksicht auf die religiösen Amerikaner, die am Sonntag in die Kirche gehen. Der Montag wurde ausgeschlossen, weil er als Anreisetag in die manchmal weiter entfernte Bezirkshauptstadt galt, wo damals noch abgestimmt werden musste.
Der Donnerstag kam nicht in Frage, weil da traditionell die Briten ihr Parlament wählten, und der Freitag, weil da stets die Vorbereitungen für den Markttag am Samstag stattfanden. Es wurde dann der Dienstag nach dem ersten Montag im November, denn der Wahltag durfte auch nicht auf den ersten Tag eines Monats fallen, da hier an vielen Orten Gericht gehalten wurde. Außerdem ist am 1. November das Kirchenfest Allerheiligen.
[Mit dem Newsletter „Washington Weekly“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/washington-weekly.]
Seit 1872 wählen die Amerikaner auch das Repräsentantenhaus an diesem Tag, und seit 1915 den Senat. Das heißt, dass alle zwei Jahre am ersten Dienstag nach dem ersten Montag in November eine wichtige Wahl stattfindet, denn die Kongressabgeordneten werden zwei Jahre neu gewählt, genauso wie ein Drittel der Senatoren.
Der Donnerstag kam nicht in Frage, weil da traditionell die Briten ihr Parlament wählten, und der Freitag, weil da stets die Vorbereitungen für den Markttag am Samstag stattfanden. Es wurde dann der Dienstag nach dem ersten Montag im November, denn der Wahltag durfte auch nicht auf den ersten Tag eines Monats fallen, da hier an vielen Orten Gericht gehalten wurde. Außerdem ist am 1. November das Kirchenfest Allerheiligen.
6. Wann schließen die Wahllokale?

Die Staaten im Osten der USA schließen nach 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit ihre Wahllokale. Mit ersten Ergebnissen kann also zu diesem Zeitpunkt gerechnet werden. Darunter ist auch der für die Wahl sehr wichtige Swing State Florida. North Carolina schließt gegen 1:30 Uhr unserer Zeit die Wahllokale. Als letztes schließt Alaska gegen sechs Uhr morgens am Mittwoch. Zu diesem Zeitpunkt dürfte man bereits eine erste Ahnung davon haben, in welche Richtung sich die Wahl bewegt – auch wenn natürlich so lang abgewartet werden muss, bis die zahlreichen eingesandten Briefwahlstimmen ausgezählt sind.
Die vollständige Auszählung der Briefwahlstimmen kann sich in einige Tage oder sogar Wochen hinziehen. Denkbar ist auch eine nachträgliche „blaue Welle“ – denn unter den Briefwählern sind in der Regel mehr demokratische Wähler als republikanische. Allerdings: Donald Trump forderte in diesem Jahr seine Anhänger dazu auf, frühzeitig oder per Post zu wählen.
7. Wer darf wählen und wie funktioniert die Wählerregistrierung?

Wählen dürfen alle US-Bürger, die älter als 18 Jahre sind und keine Vorstrafen aufweisen, insgesamt etwa 200 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner. In manchen Staaten gibt es eine Ausnahmeregelung, hier darf man schon ab 17 wählen. Grundsätzlich muss man sich aber in fast allen Staaten für die Wahl registrieren. Das System der Wahlregistrierung ist etwas komplizierter, da es in den USA – anders als in Deutschland – keine Meldepflicht und keine Einwohnermeldeämter gibt. Wie man sich registrieren kann, ist in den Bundesstaaten unterschiedlich geregelt, ebenso wie die Fristen dafür. In den meisten Bundesstaaten kann man sich online für die Wahl registrieren.
8. Wie hoch ist die Wahlbeteiligung in den USA?
Für 2024 kann man das noch nicht vorhersagen. Eventuell könnte die vergangene Wahl jedoch ein Vorzeichen für eine hohe Wahlbeteiligung auch in diesem Jahr gewesen sein. 2020 gab es einen Rekord von 66,3 Prozent. Das war der höchste Wert seit der Präsidentschaftswahl im Jahr 1900. Für Biden stimmten 2020 über 81 Millionen Menschen, mehr als jemals zuvor für einen Präsidenten. Trump wählten rund 74 Millionen.
Viele Millionen Amerikaner werden per Briefwahl allerdings bereits vor dem 5. November ihre Stimme abgegeben haben. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Wahlbeteiligung in den Vereinigten Staaten selten mehr als 60 Prozent beträgt, seit 1980 lag sie in den Vereinigten Staaten im Schnitt bei etwa 63 Prozent (in Deutschland lag sie im gleichen Zeitraum bei etwa 80 Prozent). Bei der Wahl 2016 gaben 137,5 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Stimmen ab, das ergab eine Wahlbeteiligung von etwa 60 Prozent.

9. Welche Rolle spielen Briefwahl und „early voting“ in diesem Jahr?
In den USA gibt es die Möglichkeit entweder per Post oder persönlich vorab zu wählen – die Anzahl derjenigen, die dieses Jahr ihre Stimme schon per Post abgegeben haben, ist bereits hoch, wie man an zwei wichtigen Staaten sehen kann. In Florida gingen bis Mitte Oktober bereits mehr als 600.000 Briefwahlstimmen ein; in Georgia wurde sogar ein Rekord gebrochen: Mehr als 300.000 wurden am ersten Tag des sogenannten „early voting“ abgegeben. 2020 waren es offiziellen Angaben zufolge 136.000.
Hier dürfte ein entscheidender Unterschied zur vergangenen Wahl liegen. Der Grund: 2020 war die Wahl stark von der Coronapandemie beeinflusst. Mehr als 65 Millionen Amerikaner stimmten damals per Briefwahl ab – ein Rekord.

Zwar wird erwartet, dass die Zahl in diesem niedriger ausfallen wird. Doch trotzdem dürfte die Briefwahl die Organisatoren, aber auch für die Post eine Herausforderung werden. Wahlunterlagen müssen rechtzeitig verschickt werden, damit sie fristgerecht ausgefüllt wieder zurückkommen. Klappt das nicht, könnten Millionen Stimmen nicht ausgezählt werden. Dazu kommt, dass in vielen Staaten die Briefwahlstimmen erst nach den am Wahltag abgegebenen Stimmen ausgezählt werden. In Swing States, wo es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen kann, muss daher damit gerechnet werden, dass ein Sieger erst Tage oder gar Wochen nach dem 5. November feststeht.
Grundsätzlich muss man hier zwischen dem „Absentee Voting“ und dem „Mail-In-Voting“ unterscheiden. „Absentee Voting“ erlaubt Wählern seit mehr als 150 Jahren, aus der Ferne zu wählen – das ist zum Beispiel für ältere Menschen in Pflegeheimen oder Soldaten im Ausland wichtig.
Bei der vergangenen Wahl war das Abstimmten per Post für Donald Trump ein Anlass für seine Falschbehauptungen eines Wahlbetrugs. Trump behauptete monatelang, dieses Vorgehen sei besonders betrugsanfällig. „Es ist unmöglich, eine Briefwahl ohne massiven Betrug durchzuführen“, sagte er damals. Er ließ sich von dieser These auch nicht dadurch abhalten, dass nicht nur Experten, sondern auch Behörden das anders sahen. Belege dafür, dass diese Art der Briefwahl Betrug in großem Ausmaß ermöglicht, gab es nicht.
Dieses Mal jedoch ist die Situation anders. Zwar spricht er auf seinen Wahlkampfveranstaltungen immer noch von der angeblich für Betrug anfälligen Briefwahl und sagt, die Post in den USA sei in schlechter Verfassung. Zugleich fordert seine Kampagne die Amerikaner auf, zum „early voting“ zu gehen – und per Brief zu wählen.
10. Was passiert, wenn Trump im Falle einer Niederlage die Wahl 2024 nicht anerkennt?
Die Ereignisse des 6. Januar 2021 sind den Amerikanerinnen und Amerikanern in schmerzhafter Erinnerung. Um die förmliche Bestätigung des Wahlsieges Joe Bidens zu verhindern, hetzte der damalige Präsident Trump seine Anhänger in einer Rede auf. Ein Mob stürmte das Kapitol in Washington. Fünf Menschen kamen ums Leben, vielmehr wurden verletzt. Trump wurde angeklagt – und die USA erlebten einen der traumatischsten Tage ihrer jüngeren Geschichte.
Ob es im Falle einer Niederlage Trumps auch in diesem Jahr wieder zu einem Aufstand eines solchen Ausmaßes kommt, bleibt abzuwarten.
Gerechnet wird damit, dass Trump vor allem juristisch gegen ein Ergebnis vorgehen würde, das zu seinen Ungunsten ausfällt. Das tat er bereits 2020, nachdem er immer wieder behauptet hatte, es hätte Wahlfälschungen gegeben.
Auch dieses Mal möchte Trump nicht öffentlich sagen, dass er das Ergebnis der kommenden Wahl akzeptiert. Im Gegenteil: Er behauptet gegen jeden Beweis erneut, dass die Demokraten die Wahl fälschen würden.
Juristisch könnte eine mögliche Auseinandersetzung um das Wahlergebnis, wie schon bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000, letztlich vor dem Supreme Court landen. Damals entschied das oberste Gericht einen Streit um das Ergebnis in dem entscheidenden Staat Florida zwischen George W. Bush und Al Gore zugunsten von Bush – und damit die Wahl. Gore erkannte das Urteil an.
11. Am 5. November stehen einige Senatoren und das Repräsentantenhaus zur Wiederwahl. Ist das wichtig?
Am 5. November werden nicht nur ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt, sondern es finden auch Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat statt. Das ist nicht minder wichtig. Gerade die Wahl zum Senat ist entscheidend dafür, wie Amerika in den nächsten Jahren regiert wird.
Derzeit stützt sich Präsident Biden auf eine denkbar knappe Senatsmehrheit. Die Demokraten halten 47 der 100 Senatssitze, die Republikaner 49, vier Sitze sind mit unabhängigen Kandidaten besetzt, die aber zu den Demokraten gezählt werden. Vizepräsidentin Harris hat die 101. Stimme im Senat. Die Demokraten haben also eine dünne Mehrheit von 51 Sitzen und mit Harris‘ Stimme 52. 34 Sitze werden am 5. November neu besetzt. 23 davon sind in der Hand der Demokraten oder Unabhängiger.
Das Repräsentantenhaus hingegen ist in republikanischer Hand, die Partei hält dort 220 Sitze, die Demokraten 212. Es wird am 5. November komplett gewählt.
12. Was passiert am Wahltag und in der Wahlnacht?
Der Wahlabend ist vor allem ein Fernsehevent. Große Sender wie CNN nehmen die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten auf und zählen mit, welcher Kandidat wie viele Wahlmänner hat. Wer zuerst über 270 Wahlmänner kommt, wird von den Fernsehsendern als Sieger ausgerufen.
Das dürfte in diesem Jahr am Wahlabend noch nicht der Fall sein. 2020 stand erst gut drei Tage nach dem Wahltag fest, dass Biden gewonnen hatte.
Ein festes Ritual der amerikanischen politischen Kultur ist es, dass daraufhin der unterlegene Kandidat seine Niederlage förmlich und öffentlich ausspricht und dem Sieger gratuliert, in der Regel in einer „concession speech“.
2016 gratulierte HClinton ihrem damaligen Rivalen Trump telefonisch in den frühen Morgenstunden. Ihre „concession speech“ hielt sie erst am Vormittag des 9. November amerikanischer Zeit – schon für diese „späte“ Rede wurde sie kritisiert.
Trump behauptete nach seiner Niederlage 2020, dass es Wahlfälschungen gegeben habe und weigert sich bis heute zu sagen, dass Joe Biden rechtmäßig Präsident geworden sei. Eine „concession speech“ ist von ihm wohl eher nicht zu erwarten.
13. Wann wird der Sieger feststehen?
Dass ein Ergebnis am bereits am Wahlabend feststeht, ist sehr unwahrscheinlich. Beobachter glauben eher, dass es auch dieses Mal zu Anfechtungen der Wahl in einem oder mehreren Bundesstaaten kommen wird und die Wahl erst später vor Gericht entschieden wird. Medienberichten zufolge bereiten Trump und sein Team sich bereits darauf vor, ein Ergebnis zu seinen Ungunsten anzufechten.
Grundsätzlich gilt: Je eindeutiger das Ergebnis, desto schneller steht der Sieger fest, desto geringer die Zweifel. Viele hoffen auf einen großen Vorsprung von Harris für eine schnelle Klärung.
14. Wann wird der neue Präsident sein Amt antreten?

Die Amtszeit von Biden endet am 20. Januar um 12 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden Harris oder Trump auf der Westseite des Kapitols in Washington vom Obersten Richter des Supreme Court feierlich ins Amt eingeführt.
15. Was passiert zwischen der Wahl und der Amtseinführung des neuen Präsidenten?
Diese Phase scheint erstmal unspektakulär und ist doch wichtig. Immer am ersten Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember, dieses Jahr am 14. Dezember, treffen sie sich die gewählten Wahlleute in den jeweiligen Bundesstaaten, um mit ihren Stimmen den Präsidenten der USA zu wählen.
Alle Stimmzettel der Wahlleute aus den 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia werden an den Präsidenten des US-Senats gesendet. Am 6. Januar treffen sich Repräsentantenhaus und Senat zur gemeinsamen Auszählung im Kongress, der im berühmten Kapitol in Washington D.C. tagt. Der Zeitraum bis zur Amtseinführung des Präsidenten ist auch die Phase der sogenannten peaceful transition of power, also die friedliche Übergabe der Macht an den Nachfolger.
In dieser Zeit gilt der amtierende aber unter Umständen scheidende Präsident als „lame duck“, also lahme Ente, da er im Prinzip nichts mehr entscheiden kann.
Unrühmliche Ausnahme dieser eher unspektakulären Periode, in der es vor allem um Verwaltungsvorgänge geht, stellte das Jahr 2021 dar, als Trump seine Anhänger am 6. Januar aufhetzte, um das Wahlergebnis noch zu kippen.

16. Welche Rolle spielt der Supreme Court bei einem unklaren Wahlausgang?
Sollte die Wahl vor Gericht angefochten werden, sind zunächst einmal die Gerichte der Bundesstaaten zuständig – sie organisieren und verantworten den korrekten Ablauf der Wahl und sind für viele (anfechtbare) Bestimmungen zuständig, etwa bei der Wählerregistrierung, der Briefwahl, für Wahlcomputer und die Auszählung. Im Jahr 2000 landete die Wahl – wie beschrieben – trotzdem vor dem Supreme Court der Vereinigten Staaten, und zwar, weil auf einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung geklagt wurde. Auch dieses Verfahren begann vor Gerichten in Florida, wurde aber bis vor den Supreme Court getragen.
Das Gericht verhinderte, dass die Stimmen in Teilen des wahlentscheidenden Bundesstaates Florida neu ausgezählt wurden. Interessant dabei: Während der ersten Neuauszählung hatten sich die Stimmanteile zugunsten von Al Gore bewegt, Bush lag allerdings immer noch vorne. Erst als Gore in vier weiteren Landkreisen nochmals neu auszählen lassen wollte, erklärt der Supreme Court dies für verfassungswidrig. Bush wurde dadurch Präsident und Kritiker mutmaßten, dass der Supreme Court ihm dabei maßgeblich geholfen habe. Denn: Die konservative Mehrheit der Richter stimmte für, die liberalen Richter gegen das Urteil.
Spannend ist das vor allem deshalb, weil Trump in seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 für eine Mehrheit im Supreme Court gesorgt hat. Drei Richter konnte er nominieren – eine große Zahl für lediglich eine Amtszeit: Supreme-Court-Richter sind auf Lebenszeit ernannt.
2017 setzte Trump Neil Gorsuch als Verfassungsrichter ein, 2018 folgte der damals stark umstrittene Brett Kavanaugh. Nach dem Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg folgte Ende 2020 Amy Coney Barrett. Von neun Richtern sind so nur noch drei dem demokratischen Flügel und sechs dem republikanischen Flügel zuzuordnen. Sollte es zu einem ähnlich knappen und unklaren Wahlausgang kommen wie 2000, müsste das Oberste Gericht sich damit befassen. Wie die Richter in einem Fall wie Florida heute entscheiden würden, ist allerdings völlig offen.