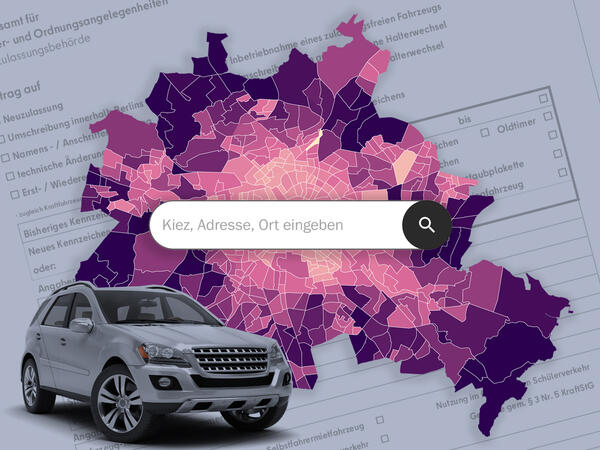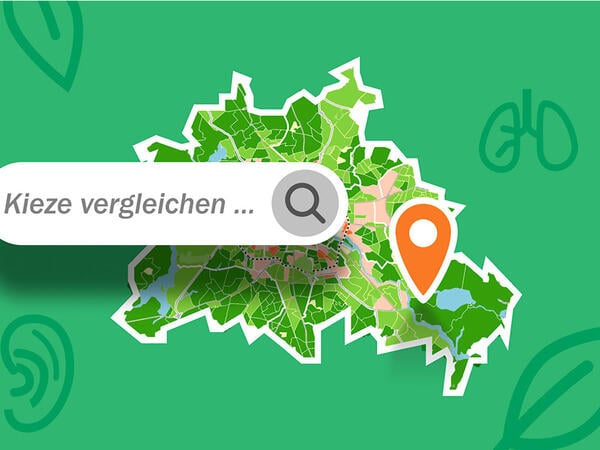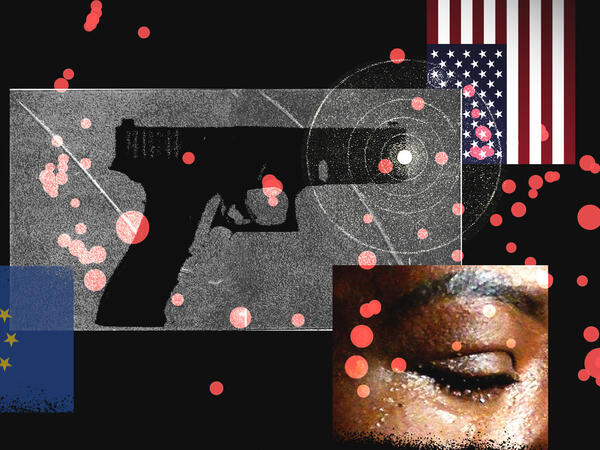Ohne Reserve:
Eine Schulleiterin kämpft mit dem Lehrkräftemangel
Bevor es losgeht: „Stopp. Liegt alles auf dem Tisch, was wir brauchen? Stifte, Heft, sonst nichts. Und Ruhe, jetzt erstmal keine Fragen. Guten Morgen.“
Es ist pünktlich 8 Uhr an einem Donnerstag Anfang September, als Karina Jehniche ihre Schüler:innen begrüßt, 22 sind es heute, zwei fehlen entschuldigt, 24 besuchen diese fünfte Klasse der Christian-Morgenstern-Grundschule also regulär. Mathematik steht für die erste Stunde des Tages im Plan.
Karina Jehniche leitet die Schule in Berlin-Spandau – und sie unterrichtet acht Stunden Mathe in der Woche. An diesem Morgen wird wiederholt: Wie heißen die unterschiedlichen Rechenoperationen und wie funktioniert die schriftliche Addition?
Die 58-Jährige hat Mathematik studiert, sie liebt das Fach. Immer noch. Selbst wenn sie sich mittlerweile größtenteils außerhalb des Klassenraums mit Zahlen auseinandersetzen muss. Die Aufgabe, an der sie sich abarbeitet, ist eine große: Die Grundschule liegt in einem Brennpunktkiez am Berliner Stadtrand. Mehr als 560 Schüler:innen besuchen die Schule. Weil viele von ihnen besondere Förderung brauchen, ergibt sich ein Unterrichtsbedarf von 1192,85 Stunden pro Woche. 53 Lehrer:innen arbeiten an der Schule, 22 von ihnen in Teilzeit, drei sind dauerhaft erkrankt. Zusammen unterrichten sie 1050,5 Stunden.
Wie viele Lehrer:innen bräuchte die Schule, um den gesamten Bedarf abdecken zu können? Und wo zur Hölle sollen die herkommen? Es scheint eine unlösbare Aufgabe zu sein, vor die der Lehrer:innenmangel Berlin stellt. Aktuell sind rund 1500 Stellen in der Stadt unbesetzt.