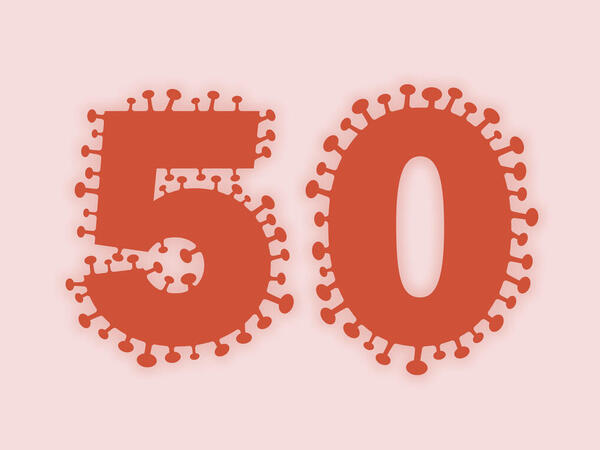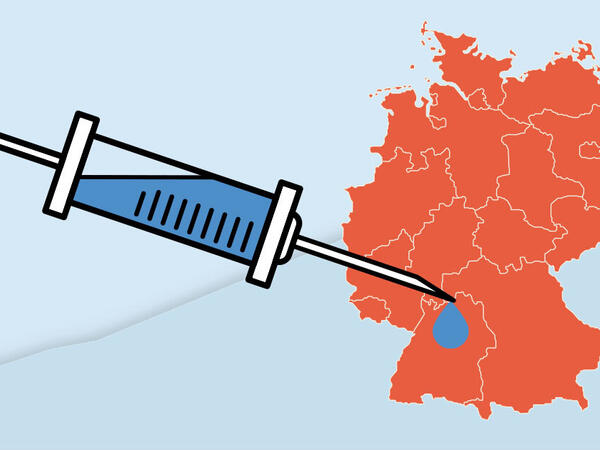Öde neue Welt?
Isolation BerlinErnüchterung, Emotionen und Experimente
In den Gedichten geht es um Liebeskummer, aber auch viel um Einsamkeit, Angst, Depression, das Hadern mit dem eigenen Ich – Themen, die sicher viele gerade umtreiben. Um nachzudenken, gehe ich oft raus, laufe im Prenzlauer Berg oder in Mitte durch die Gegend. Ich habe da auch meine feste Bank im Weinbergspark, auf der ich immer sitze, wenn es nicht so kalt ist wie gerade. Ansonsten lese ich viel – gerade Gedichte von Georg Trakl und „Mein Leben als Mann“ von Philip Roth.  Normalerweise würde ich zu Konzerten gehen, in Kneipen oder Ausstellungen, um Inspiration zu bekommen – es ist schon alles sehr einsam gerade. Soziale Medien nutze ich keine und bin auch sonst kaum im Internet. Wenn ich mich mit nutzlosen Infos aus dem Internet fülle, hab ich weniger Platz in meinem Kopf für die wichtigen Dinge. Was mir natürlich auch fehlt, sind die eigenen Konzerte. Wir haben gerade unser neues Album aufgenommen, im März erscheint die erste Single. Eigentlich würden wir das dann groß feiern, vor Publikum spielen. Es ist schrecklich, wenn man neue Songs geschrieben hat und die nicht vor Publikum spielen kann, das ist ja eine ganz eigene Energie, die man vom Publikum bekommt. Man braucht es, um die Songs mit Leben zu füllen.
Normalerweise würde ich zu Konzerten gehen, in Kneipen oder Ausstellungen, um Inspiration zu bekommen – es ist schon alles sehr einsam gerade. Soziale Medien nutze ich keine und bin auch sonst kaum im Internet. Wenn ich mich mit nutzlosen Infos aus dem Internet fülle, hab ich weniger Platz in meinem Kopf für die wichtigen Dinge. Was mir natürlich auch fehlt, sind die eigenen Konzerte. Wir haben gerade unser neues Album aufgenommen, im März erscheint die erste Single. Eigentlich würden wir das dann groß feiern, vor Publikum spielen. Es ist schrecklich, wenn man neue Songs geschrieben hat und die nicht vor Publikum spielen kann, das ist ja eine ganz eigene Energie, die man vom Publikum bekommt. Man braucht es, um die Songs mit Leben zu füllen.
Die Isolation Berlin, in der ich mich gerade befinde, ist dennoch eine ganz andere als die, aus der heraus der Bandname entstanden ist. Damals hatte ich gerade eine Trennung hinter mir und war furchtbar depressiv, saß die ganze Zeit nur mit meinem Freund und Bandkollegen Max in der Küche und habe getrunken. Die Isolation war da sehr erdrückend, ich habe mich von allen Menschen getrennt, von denen ich dachte, sie tun mir nicht gut. Die momentane Situation ist zwar auch ermüdend und ernüchternd - aber ich bin nicht in einer so schlechten emotionalen Verfassung. Vor allem habe Dinge, an denen ich arbeiten und mich festhalten kann. Und Menschen, die mich auffangen, die an mich glauben. Das dritte Album von Isolation Berlin sowie der neue Band mit Gedichten und Spelunken von Tobias Bamborschke erscheinen im Herbst 2021.
In dem Kurzfilm „Soon It Will Be Dark“ stößt man nach den ersten Minuten auf einen Mann, der im Schatten riesiger Bäume das Unterholz lichtet, und folgt ihm entlang der Küste ins Dorf, vom Tag in die Nacht und vom Dunklen wieder ins Helle. Bilder und Ton lassen eine dichte Atmosphäre entstehen, auf Dialoge verzichten wir dabei ganz. Aus dem reichlichen Material, das wir in São Tomé gedreht haben, ist ein weiterer, circa 60-minütiger Film geplant: „All The Days Inbetween.“ Eigentlich wollten wir schon längst mit dem Schnitt dafür fertig sein, doch die eingeschränkte Reisefreiheit (und eine leere Kasse) kamen uns in die Quere. Einige Szenen müssten nachgedreht werden, was bislang aber nicht möglich war.
Doch Not macht bekannterweise erfinderisch und so wird das experimentelle Format durch ein weiteres Experiment ergänzt: Die teilnehmenden Laiendarsteller selbst haben angefangen, nach unseren Regieanweisungen weiterzudrehen. Dazu benutzen sie das Equipment, das sie haben – ihre Handys. Circa einmal pro Woche bekomme ich die neuen Aufnahmen geschickt und wir senden unsere Kommentare zurück. Der Fortschritt ist recht gemächlich, aber wir haben ja Zeit! Die Videos, die wir auf diese Weise erhalten, überraschen immer wieder von Neuem mit einem lässigen Esprit, der kaum zu übertreffen ist. Darüber hinaus entstehen Konstellationen, die ursprünglich gar nicht so eingeplant waren, aber nicht mehr wegzudenken sind.  Die Darsteller filmen mit maximaler Unbefangenheit und ermöglichen damit einen viel tieferen Einblick in ihr Leben, als wir das mit unserer Kamera wohl je geschafft hätten. Die Arbeit an dem Projekt hilft mir enorm durch den Lockdown, weil sie eine Art innere Parallelwelt erzeugt – selbst, wenn ich nicht direkt vor den Bildern sitze, habe ich sie vor Augen. Die Vorstellung, mit dem fertigen Film irgendwann wieder zu Festivals reisen zu können, hält mich über Wasser. Für „Soon It Will Be Dark“ ist das leider nur sehr eingeschränkt möglich. Dass in diesem Jahr sogar die Berlinale nicht richtig stattfinden kann, ist wirklich deprimierend. Für mich sind diese zehn Tage im Februar sonst immer ein Highlight der grauen Berliner Jahreszeit. Es sind Leerstellen, die sich da auftun und unser Leben schleichend verändern. Umso wichtiger ist es, dass man sich an spannenden Ideen festhält. Dazu gehört für mich auch die Arbeit an meinen Keramiken – glücklicherweise habe ich mein Studio zu Hause in Prenzlauer Berg, und kann dort ziemlich unabhängig von der Krise arbeiten.
Die Darsteller filmen mit maximaler Unbefangenheit und ermöglichen damit einen viel tieferen Einblick in ihr Leben, als wir das mit unserer Kamera wohl je geschafft hätten. Die Arbeit an dem Projekt hilft mir enorm durch den Lockdown, weil sie eine Art innere Parallelwelt erzeugt – selbst, wenn ich nicht direkt vor den Bildern sitze, habe ich sie vor Augen. Die Vorstellung, mit dem fertigen Film irgendwann wieder zu Festivals reisen zu können, hält mich über Wasser. Für „Soon It Will Be Dark“ ist das leider nur sehr eingeschränkt möglich. Dass in diesem Jahr sogar die Berlinale nicht richtig stattfinden kann, ist wirklich deprimierend. Für mich sind diese zehn Tage im Februar sonst immer ein Highlight der grauen Berliner Jahreszeit. Es sind Leerstellen, die sich da auftun und unser Leben schleichend verändern. Umso wichtiger ist es, dass man sich an spannenden Ideen festhält. Dazu gehört für mich auch die Arbeit an meinen Keramiken – glücklicherweise habe ich mein Studio zu Hause in Prenzlauer Berg, und kann dort ziemlich unabhängig von der Krise arbeiten.  Momentan entwickle ich ein größeres Projekt für zwei Ausstellungen, die im Juni 2021 bei Mehdi Chouakri in Berlin und Norma Mangione in Turin gezeigt werden. Dazu übersetze ich gemalte Vasen aus den extrem bunten Blumenstillleben eines italienischen Malers zurück in die Dreidimensionalität. Es ist also quasi das Gegenteil zur Arbeit am Film, wo ja die Realität zum Bild wird. Für mich ist es eine ganz neue Erfahrung, nach Vorlagen zu arbeiten. Erstaunlicherweise gibt sie mir viele Freiheiten! Der Spagat zwischen den beiden Medien füllt meinen Alltag voll aus: Abwechselnd im Licht der Tropen vor dem Bildschirm, oder bei stundenlanger Handarbeit im Studio habe ich nicht das Gefühl draußen viel zu verpassen.
Momentan entwickle ich ein größeres Projekt für zwei Ausstellungen, die im Juni 2021 bei Mehdi Chouakri in Berlin und Norma Mangione in Turin gezeigt werden. Dazu übersetze ich gemalte Vasen aus den extrem bunten Blumenstillleben eines italienischen Malers zurück in die Dreidimensionalität. Es ist also quasi das Gegenteil zur Arbeit am Film, wo ja die Realität zum Bild wird. Für mich ist es eine ganz neue Erfahrung, nach Vorlagen zu arbeiten. Erstaunlicherweise gibt sie mir viele Freiheiten! Der Spagat zwischen den beiden Medien füllt meinen Alltag voll aus: Abwechselnd im Licht der Tropen vor dem Bildschirm, oder bei stundenlanger Handarbeit im Studio habe ich nicht das Gefühl draußen viel zu verpassen.
ArbeitStillstand, Sorgen und Selbstlosigkeit
Von jetzt auf gleich ein komplettes System zu ändern, bringt Probleme mit sich. Eine Bekannte von mir hat sich ihren Tower-PC mit nach Hause genommen, um dort arbeiten zu können. Ich finde das gut, weil sie zu den Risikopatienten gehört und sich so nicht unnötigen Gefahren aussetzt. Trotzdem ist es veraltete Technik. Sie arbeitet für den Staat und meiner Meinung nach wird dort am meisten gespart. Für mich ist es normal, einen Arbeitslaptop zu haben, von dem ich mich überall über eine sichere Verbindung ins Internet einwählen und arbeiten kann. Die Technik dazu kommt vom Arbeitgeber. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, die gesamte Technik bei mir zu Hause aufbauen zu müssen.
Bei einer anderen Bekannten ist es noch schlimmer: Sie arbeitet für das Land Brandenburg und muss für mobile Tage ihre eigenen Geräte verwenden, um E-Mails zu beantworten. Ganz grauenvoll! Deswegen sehe ich es zwar positiv, dass durch Corona diesbezüglich ein Umdenken stattfindet. Anscheinend ist es so, dass nur durch diese neue Situation überhaupt mal was gemacht wird. Aber wenn ich sehe, wie es umgesetzt wird, graut es mir. Nicht nur, dass die Ausstattung veraltet und nicht mobil ist, sondern auch die Technik. Wenn sich da nichts ändert, sehe ich schwarz. Wenn in Deutschland nicht endlich mehr für die Digitalisierung getan wird, machen wir uns genauso abhängig von anderen Staaten wie zu Corona-Zeiten von China – beispielsweise für Masken und Medikamente.
Mein Online-Shop ist zum Glück stark, darauf lässt sich aufbauen. Mein „geschrumpftes“ Team wunderbarer Mitarbeiter arbeitet konzentriert von zu Haus, ruft #supportyourlocals ins Leben und empfiehlt Berliner Brands, die es in der Krise nicht leicht haben. Und beschafft für #carepaket tausende kleine Geschenke von Kooperationspartnern, die wir an Berliner Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern verteilen werden (auch der Tagesspiegel ist mit dabei!).
Und dann kommt Hilfe von der Berliner Landesbank, die uns durch die kommenden Wochen bringen wird. Schnell, unkompliziert, fair. Was für ein Glück, in einem Staat zu leben, der uns in dieser Ausnahmesituation kompromisslos unterstützt. Dafür will ich Danke sagen! Vielleicht sind Krisen Katalysatoren des Fortschritts. Heute will und muss ich das glauben. Vielleicht ist heute die Zeit, Dinge neu zu denken. Ich fange gerade damit an.
Nachtrag, ein Dreivierteljahr später: Mein Team und ich, wir haben die neuen Mechanismen verstanden, die den künftigen Erfolg des Einzelhandels ausmachen werden. Unser Online-Shop ist offensiver, verführerischer. Interaktive Elemente mögen unsere Kunden; wir verkaufen unsere Manufaktur-Düfte jetzt spielerischer mit einem erweiterten Dufttest und ein neuer Blog gibt Tipps: Designer, Schauspieler und befreundete Brands erzählen, warum für sie alles Olfaktorische wirklich wichtig ist. Und sie erzählen, warum sie unsere Parfums so sehr mögen. In den Sozialen Medien konnten wir die Anzahl unserer Follower verdoppeln, die vielen positiven Zuschriften und Kommentare machen glücklich. Aktuell entwickeln wir einen neuen Duft, der von dem Moment erzählen wird, an dem wir alle uns von einer Last befreit fühlen werden. Der Duft arbeitet mit zarten Blüten, wilden Früchten und edlen Hölzern. Und erzählt von einer langen Reise zu uns selbst.
Dann würden unsere Patientinnen zwar mit geringerer Wahrscheinlichkeit infiziert werden und an Corona sterben, stattdessen aber an entgleistem Diabetes, Blutvergiftung oder sie würden verdursten. Das ist keine Alternative! Unsere Leute müssen also raus und riskieren, dass sie angesteckt werden oder andere anstecken. Ich neige mein Haupt in tiefer Achtung vor dem Mut und der Selbstlosigkeit meiner Leute! Für mich als Arbeitgeber fühlt sich das nicht gut an. Ich bin verpflichtet, durch alle denkbaren Maßnahmen das Risiko, dass meine Mitarbeiterinnen bei der Arbeit zu Schaden kommen, auf das Minimum zu senken.
Wir haben deshalb einige Maßnahmen getroffen. Diese Regelungen widersprechen zum Teil diametral unserem Berufsethos und unseren sonstigen Verfahrensweisen, die auf kollegialen Austausch und soziale Annäherung an unsere Klientel ausgerichtet sind. Wir haben alle betriebsinternen Gruppenversammlungen abgesagt. Pflegeübergaben finden nicht mehr im persönlichen Gespräch, sondern nur noch telefonisch oder schriftlich statt. Dienst-PKWs werden von den Kolleginnen nach ihrer Tour mit nach Hause genommen – was ansonsten grundsätzlich verboten ist – um ihnen Wege ins Büro zu ersparen.
Und der kollegiale Plausch im Büro – eigentlich unerlässlich für die Psychohygiene – entfällt seit Wochen. Meinen Job als Geschäftsführer erledige ich im Homeoffice und zwei- bis dreimal wöchentlich nach der Öffnungszeit, zum Teil nachts, im Büro. Kürzlich hatten wir den ersten „Verdachtsfall“ in unseren Reihen, alle hielten den Atem an: Wem ist die Kollegin begegnet? Wenn sie positiv getestet wird und ausfällt: Welcher „Dominoeffekt“ beim Rest der Pflegekräfte ist zu erwarten? Wie sollen wir dann die Patientinnen versorgen? Zwei Tage später Entwarnung: Der Test war negativ. Aber in der Magengrube bleibt das Gefühl: Wenn wir umfallen, passieren ganz schreckliche Dinge.
Nachtrag, ein Dreivierteljahr später: Unser Leitungsteam, bestehend aus zwei Pflegedienstleitungen und vier Verwaltungsmitarbeiterinnen, ist sehr schnell zu der Einschätzung gelangt: Wenn der Kopf fehlt, geht gar nichts mehr. Der würde fehlen, wenn eine der sechs Leitungsmitarbeiterinnen positiv getestet würde und alle anderen fünf in Quarantäne müssten. Also haben wir bereits im Frühjahr zwei halbe Teams gebildet mit je einer Pflegedienstleitung und zwei Verwaltungsleuten, die alternierend Montag, Mittwoch, Freitag bzw. Dienstag, Donnerstag und Samstag arbeiten und sich nie sehen. Wird eine positiv getestet, fällt das Team aus, aber das andere kann noch arbeiten und „den Laden am Laufen halten“.
Im Sommer haben wir mit dieser Praxis pausiert; seit Anfang Dezember arbeiten wir aber wieder so. Das bedeutet eine enorme Belastung für jene, die gerade im Büro arbeiten: Sie arbeiten oft zehn Stunden oder mehr am Tag. Seit wir von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Pflege verpflichtet wurden, die Pflegekräfte alle zwei Tage auf Corona zu testen, ist der Stress noch gestiegen. Die sechs Pflegefachkräfte, die dafür qualifiziert wurden, testen, wann immer es möglich ist. In dieser Zeit können sie ihren eigentlichen Job aber nicht mehr machen.
Bei all dem verstoßen wir gegen die Regelungen der neuen Rechtsverordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit vom 16.12.2020. In der heißt es unter anderem sinngemäß: Wer nicht alle zwei Tage getestet ist, darf nicht mehr für körpernahe Pflegeleistungen eingesetzt werden. Da wir diesen Takt nicht durchhalten können, müssten wir etliche Kolleginnen „aus dem Verkehr ziehen“ mit der Folge, dass Pflegebedürftige unversorgt blieben. Das tun wir nicht, weil aus unserer Sicht die gesundheitlichen Risiken, beispielsweise infolge unterlassener Insulininjektionen, viel größer wären als jene, die aus einem „weitmaschigeren“ Testtakt erwüchsen. Ich habe deswegen schon eine Überlastungsanzeige an die Senatsverwaltung geschickt – ohne Reaktion. Die Verantwortung dafür, sich zwischen Teufel und Beelzebub zu entscheiden, haben weder die Politik noch die Pflege- und Krankenkassen übernommen. Das müssen wir Pflegedienste tun. Machen wir auch, aber wir müssen damit rechnen, dafür bestraft zu werden.
GesundheitKrankheit, Kraft und Kostbarkeit
Meine Mama ging danach in Mecklenburg-Vorpommern in Quarantäne, wo sie mein Vater versorgte, und ich in die Uckermark, wo mein lieber Mann sich um mich kümmerte. Durch Corona musste ich nun noch mehr auf mich aufpassen und war sehr viel allein, jedoch musste ich auch erst einmal richtig zu Kräften kommen, was mir schneller als meiner Mama gelang. Mein Mann war zwar erst im Homeoffice, aber nicht permanent für mich ansprechbar – er arbeitet für eine große Bank. Am 1. Juni ging er wieder ins Büro. Meine Angst wuchs, dass er mir Covid-19 einschleppen würde, was mein Überleben vermutlich in große Gefahr bringen könnte.
Meine geliebte Tochter, die in Berlin lebt, sah ich Monate lang gar nicht. Als dann die Lockerungen kamen, fassten wir Pläne für kleine Treffen mit der Familie. Alles wurde bisher abgesagt, weil zwei Mal Corona im nahen Umfeld bestand und ein weiteres Mal einer meiner Neffen einen starken Infekt hatte. An meinem Geburtstag im Mai habe ich das letzte Mal meine Eltern gesehen. Meine Schwester war mit meinen Neffen vergangene Woche zu Besuch.
Ich will wirklich nicht jammern, ich bin sehr dankbar. Was ich für ein Glück habe und welch tolles Geschenk ich bekommen habe, dank des Mutes und der Gesundheit meiner Mami! Ein Leben wie dieses zu führen – was nicht heißen soll, dass man nach einer Nierentransplantation gesund ist – ist wahres Glück, für mich jedenfalls. Ich war nicht an der Dialyse, es war eine Direktlebendspende – das ist das Beste für den Körper und die Lebensleistung der Spenderniere. Die meisten warten zehn Jahre auf eine Niere.
Nun gehen alle wieder ihren Beschäftigungen nach und sind im Stress. Es ist genau wie im letzten Sommer recht einsam um mich geworden. Viele möchten mit Krankheit nichts zu tun haben und lösen das mit Abstand. Ich bekomme als 47-jährige Frau jetzt schon einmal den Eindruck, wie manche alten Menschen leben und wie es wäre, wenn ich als alte Omi allein in unserem alten Haus sitzen würde. Genau wie meine Oma – der Garten war jedoch immer da. Diese Leidenschaft teile ich mit ihr. Leider darf ich dieses Jahr nicht buddeln, jedoch genießen, und das tue ich in vollen Zügen.
Wenn ich nächstes Jahr wieder in unserem so nah gelegenen See baden darf und Mamis Niere mich hoffentlich weiterhin so fein funktionieren lässt, dann blicke ich auf diese Zeit zurück und sage mir: Siehst du, auch das hast du gemeistert. Allen Einsamen und Kranken in dieser schweren und auch mit Ängsten behafteten Zeit wünsche ich nur das Beste.
Das geht erst im April. Dieses Rezept können sie aber nicht mit der Post schicken, denn da das neue Quartal beginnt, müssen sie meine Krankenkassenkarte einlesen. Ich frage, ob ich die Karte nachreichen kann. Nein, kann ich nicht. Ich will der Arzthelferin gerade sagen, dass der Altersdurchschnitt der Patienten in ihrer Praxis sehr hoch ist, da hat sie eine Idee: Sie kann alles vorbereiten, dann muss ich nur kurz in die Praxis reinhuschen. Dass ich dafür ewig durch Berlin tingeln muss – ich habe kein Auto – lässt sich wohl nicht vermeiden. Ich brauche die Tabletten. Wenn ich sie nicht einnehme, begünstigt dies Depressionen und Schlafstörungen. Ich denke nach.
Kann mein Hausarzt nicht einen Kollegen in meiner Nähe informieren – dann könnte ich dort das Rezept abholen? „Versuchen Sie Ihr Glück!“ sagt die Arzthelferin und beendet das Gespräch. Sie lässt mich sprachlos zurück: Wieso eigentlich mein Glück? Mir könnte es egal sein. Ich bin jung, trotz Hashimoto ist ein symptomfreier Verlauf des Coronavirus nicht ausgeschlossen. Ich bin enttäuscht, aber um eine Erfahrung reicher. So schlimm kann keine Pandemie sein: Die deutsche Bürokratie funktioniert weiter.
Familie und FreundschaftZaunbesuche, Zwillingsschwestern und Zweisamkeit
Es waren Semesterferien, wir als Eltern haben im Homeoffice gearbeitet, die Familie war 24/7 zusammen. Wir haben jeden Tag zusammen das Essen geplant, gekocht und gegessen, Skat gespielt oder gepuzzelt, uns abends gemeinsam vor der Tagesschau auf dem Sofa versammelt und die erlaubten Radtouren an der frischen Luft verbracht.
Corona hat mir neben allen Einschränkungen und Ängsten eine Wiederholung von Familienzeit geschenkt, die ich so weder erwartet noch gefordert hätte. Als meine Tochter heute an ihren Studienort zurückfuhr, kamen mir die Tränen.
Außerdem lag der atlantische Ozean zwischen uns. Das richtige Kennenlernen haben wir vergangenes Jahr nachgeholt. Und vielleicht auch ein paar Schritte übersprungen.
Zum ersten Mal sahen wir uns in New York auf einer Party. Ich war bei einer Freundin zu Besuch. Und wir haben offensichtlich einen bleibenden Eindruck beieinander hinterlassen. 2019 fingen wir dann – quasi aus dem Nichts – wieder an, einander zu schreiben. Es wurde immer mehr. Bis wir Anfang 2020 entschieden, uns im April in Mailand zu treffen. Dann kam Corona. Aus dem Treffpunkt Mailand wurde Berlin. Aus Berlin wurde erst mal auch nichts.
Aber aus den täglichen Nachrichten wurden durchtelefonierte Nächte. Bis für beide feststand, dass wir das Verrückte wagen wollen: eine gemeinsame Zukunft in Deutschland. Bevor es jedoch zu verrückt wird: Eric, inzwischen mein Freund, hatte tatsächlich auch vorher schon den Plan gefasst, nach Deutschland zu ziehen. Unsere Gefühle haben das Ganze aber vielleicht ein bisschen beschleunigt. Doch nicht nur die Gefühle haben uns 2020 ziemlich überrumpelt. Auch Corona hat ordentlich zu dem einen oder anderen Überraschungsmoment beigetragen. Während wir fleißig Pläne für unsere Zukunft machten, wurden diese immer wieder ins Unbestimmte vertagt.
Die große Erleichterung kam im August, als die deutsche Regierung entschied, dass feste Partner aus Drittstaaten nach Deutschland einreisen dürfen. Eric begann, seine Zelte in New York abzubrechen, seine Wohnung zu kündigen und – endlich – einen Flug nach Deutschland zu buchen. Es dauerte schließlich bis Oktober, bis wir uns am Frankfurter Flughafen in die Arme nehmen konnten. Wer hätte gedacht, dass Küssen mit Maske auch etwas Romantisches haben kann! Seitdem haben wir keinen Tag mehr getrennt verbracht, Weihnachten und Silvester zusammen gefeiert, aber vor allem: unsere Entscheidung keinen Tag bereut. Fehlt nur noch Ernest, Erics Kater. Er kommt voraussichtlich im Februar aus New York nach.
Meine Mama hat einen Tagesplan gemacht. Morgens um acht Uhr gibt es Frühstück. Davor muss ich mich fertigmachen für den Tag und meinen Schreibtisch aufräumen. Um neun Uhr habe ich eine Stunde Arbeitszeit. Danach machen wir ungefähr eine halbe Stunde Sport mit Youtube-Videos. Dann spiele oder lese ich und dann kommt meine zweite Stunde Arbeitszeit. Zwei Stunden Arbeitszeit sind viel weniger als in der Schule, das finde ich gut. Aber mit Mama streite ich mich manchmal, weil sie mir immer alles erklären will und ja nicht meine Lehrerin ist! Ich vermisse meine Freunde und meine Lehrer schon ein bisschen, aber mit Mama und meinen Schwestern ist es auch schön.
Einmal am Tag gehen wir raus und fahren Fahrrad, gehen spazieren oder sammeln schöne Dinge aus der Natur. Ich darf auch jeden Tag 30 Minuten Fernsehschauen oder eine App auf Mamas Handy spielen. Ich habe eigentlich keine Angst vor dem Coronavirus, nur davor, dass meine Oma krank werden könnte.
Da setzte ich mich nicht mehr mit der Frage auseinander, ob ich einen fremden Mann in einer fremden Stadt besuchen sollte. Ich fragte mich eher, wie viele andere junge Menschen, ob ich in das Zuhause meiner Eltern zurückkehren sollte, um zumindest die Freiheit eines Gartens zu haben.
Umso überraschender war für mich dann ein Abend im Juni, als ich das erste Mal seit Monaten wieder in den Genuss eines Barbesuchs kam. Auf meine beschwipste Frage, ob er nicht mal wieder Freundinnen in Berlin besuchen würde, machte er direkt den Vorschlag, ein ganzes Wochenende mit mir zu verbringen. Vor allem bestand der Vorschlag aber darin, diese Zeit auch BEI mir zu verbringen – rührend rücksichtsvoll ob aller Unannehmlichkeiten, dir mir daraus entstehen könnten. Ich sagte zu. Einen Monat später verbrachte ich mit ihm eines meiner vielleicht schönsten Wochenenden jemals.
Von da an ging alles ganz schnell und wir besuchten uns immer wieder gegenseitig. Ich wollte ihn unbedingt festhalten und diese selten gewordene Stabilität in jenen verrückten Zeiten wahren. Und so entwickelte sich am Ende doch ganz unverhofft eine Liebe im Corona-Jahr. Nach Ankündigungen neuer Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung greife ich zwar immer wieder panisch nach meinem Handy, um die genauen Regelungen zu finden, die die Ausnahme von Bewegungsbeschränkungen für „Ehe- und Lebenspartnerinnen“ bestätigen. Doch trotz der Angst, dass wir uns plötzlich nicht mehr sehen können, war 2020 für mich kein verlorenes Jahr. Und ich bin sicher, dass es 2021 auch nicht sein wird.
Die Begegnungen finden im Heim-Garten voneinander getrennt durch einen Zaun statt, zweimal die Woche für jeweils 15 Minuten. Daher ist das zurzeit schöne Wetter ein Segen, lässt es doch Treffen im Grünen zu. Das tröstet aber nicht darüber hinweg, den geliebten Menschen nicht mehr umarmen zu können. Da sind kleine Kartengrüße, die ich mitgebe, mir ein kleiner Ausgleich. Und da ist der Gedanke als Begleiter, der einem sagt, dass dieses Geschehen noch über Monate hinweg dauert und ein Ende nicht abzusehen ist.
Ich bekam zwei Zuschriften. Mit dem einen war der Kontakt kurz, unsere Interessen waren zu verschieden. Mit dem anderen verabredete ich mich. Wir kamen leicht ins Gespräch, mir gefiel, wie begeistert er von seinem Beruf erzählte, seine Augen dabei strahlten. Mir gefiel sein Humor. Wir trafen uns wieder zum Spaziergang in „unserem“ heiß geliebten Berliner Kiez. Dann kam das Kontaktverbot. Keine gemeinsamen Spaziergänge mehr, Sitzen auf einer Bank, sich buchstäblich näherkommen, keine erste scheue Umarmung.
Wir sind uns sympathisch, können gut miteinander reden, haben uns viel zu erzählen und sind neugierig aufeinander. Wir waren uns schnell einig, wir bleiben zu Hause − und seitdem telefonieren wir beinahe täglich. Wir lernen uns kennen und inzwischen begleitet mich ein leises Herzklopfen, wenn wir miteinander telefonieren. Wie es ihm wohl dabei geht?
Dieser besondere Geburtstag sollte nun trotz Corona gefeiert werden. Ein genialer Einfall der Verlobten brachte die Lösung. Die beiden leben in einer Vierer-WG, die die stattliche Anzahl von etwa zwölf elektronischen zur digitalen Kommunikation geeigneten Endgeräten aufweisen kann. Also wurde beizeiten heimlich eine Verabredung mit allen Gratulantinnen getroffen, zu einer bestimmten Zeit mittels des heimischen Computers erreichbar zu sein.
Das Geburtstagskind wurde dann für kurze Zeit in die Küche gesperrt, bis alle Teilnehmer solo oder zu mehreren auf verschiedenen Bildschirmen anwesend waren, jeweils mit Kerze, Kuchen, Sektgläsern oder Geburtstagshütchen und Tröte. Wieder ins Zimmer geführt, sah sich die Hauptperson umrundet von vielen Menschen auf großen und kleinen Bildschirmen, die im Zimmer aufgebaut waren und bereit waren zum Feiern! Eine gelungene Überraschung und viel Spaß für die ganze Geburtstagsgesellschaft.
ReisenTräume, Tristesse und teure Taxis
Plötzlich wurden alle Aktivitäten gestoppt. Senegal meldete Anfang März seinen ersten Coronafall. Um die Ansteckung und Ausbreitung des Virus einzudämmen, entschied sich die senegalesische Regierung, die Grenzen zu schließen. Bis zum heutigen Tag wurde das nicht aufgehoben. Zusätzlich verkündete der Präsident in einer Fernsehansprache einen Notstand. Der ist mit einer Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens verbunden. Diese Maßnahme hat mich sehr getroffen, zumal ich für den 31.03.2020 einen Flug nach Deutschland gebucht und bezahlt hatte. Anfang April sollte mein freiwilliges soziales Jahr in einer Klinik in Deutschland beginnen. Noch ist nicht entschieden, ob ich den Flug antreten kann. Momentan bin ich blockiert, ich kann nicht nach Deutschland, nicht in die Universität in Dakar oder den Koranunterricht geben. Die Schulen sind auch im Senegal geschlossen.
Hinzu kommt die wirtschaftliche Lage. Öffentliche Verkehrsmittel sind sehr teuer geworden. Da die Plätze in Bussen und Taxis auf ein Minimum beschränkt wurden, kam es zu Preiserhöhungen. Auch meine Eltern, die 15 Kilometer von mir entfernt wohnen, kann ich vorerst nicht mehr besuchen. Überlandfahrten sind nicht erlaubt und bei den hohen Preisen ist mir eine Fahrt nicht möglich. Essen, Schlafen, Fernsehen und Hausarbeit stehen nun auf meinem Programm. Da ich bei meiner Tante mit ihren zwei Kindern wohne und sie aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zu Hause bleiben muss, helfe ich bei der Hausarbeit ihres großen Hauses mit Garten. Ich mache das Haus sauber, gieße die Pflanzen im Garten, bereite den Esstisch vor und mache Tee.
Für einen Mann in meinem Land ist das sehr ungewöhnlich. Es wird als Aufgabe der Frau betrachtet. Das ist mir jedoch egal. Ich empfinde es als notwendig und hilfreich. Inzwischen kann ich mich auch anderen Themen widmen wie Lesen und Schreiben. Ich habe Zeit für senegalesische und deutsche Literatur, zum Beispiel „Ein so langer Brief“ von Mariama und „Was bleibt“ von Christa Wolf. Die Coronazeit wird sicher nicht nur mir in starker Erinnerung bleiben.
Wir fielen zunächst in ein tiefes Loch aus Traurigkeit und Tristesse. Dazu kam die große Sorge, bloß nicht krank zu werden. Die Angst, seine Arbeit zu verlieren, betraf nicht uns, aber unsere Freunde. Wir, die im öffentlichen Dienst tätig sind, wurden kurzzeitig von der Arbeit freigestellt.
Dann war klar: Wir bleiben zu Hause! Gehen nur einkaufen, wenn es nötig ist und tätigen keine Hamsterkäufe. Wir beide gehen – beieinander untergehakt – als Liebespaar für eine halbe Stunde durch die einheimische Sonne und genießen hier die Zweisamkeit.
Wir bleiben zu Hause! Dort krönen wir unsere gemeinsame Zeit, indem wir unseren Partner nicht nur bildlich gesehen auf Händen tragen. Meiner lieben Frau lese ich die Wünsche von den Augen ab, noch bevor sie sagt: „Bring doch bitte den Müll nach draußen zur Tonne“.
Wir genießen die Situation, die Nähe zum eigenen Mann oder zur Frau zu suchen, um einander sehr vertraut und wieder nah zu sein. Alltäglichkeiten wollen wir nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern uns auch mal wieder mit einer netten Geste bedanken. Jetzt bekommen wir das, was wir in dem angestrebten Urlaub erleben wollten, auch hier. Wir machen aus der Krise das Beste. Meine Frau und ich versuchen eine gewisse Art von Urlaubsstimmung zu erzeugen. So bringen wir dem Partner einen wohlschmeckenden Cocktail auf den sonnendurchfluteten Balkon mit den Worten „Haben sie sonst noch einen Wunsch, Madam“? Oder wir duschen gemeinsam unter einem Regenduschkopf, machen die Augen zu und denken uns, wir sind auf dem Heimweg zu unserem Bungalow und werden von einem warmen Monsunregen überrascht.
Wir zaubern uns in der eigenen Wohnung unser eigenes Paradies. Hier sind wir Eva und Adam, denen nichts etwas anhaben kann. Wenn wir es lange so aushalten können, werden wir auch das Virus überleben. Wir bleiben immer zwei Menschen, die sich und andere Menschen lieben und sich ihr eigenes virtuelles Paradies nicht kaputt machen lassen, sondern genießen es rückhaltlos.
Was wir im Urlaub mit fremden Menschen bisher als etwas Besonderes angesehen haben, sollte jetzt jeder auch hier zu Hause seinen Mitmenschen und Nachbarn antun. Freundlich, hilfsbereit, zuvorkommend, nett und höflich jedem gegenübertreten und ihn als das ansehen, was er ist: ein Mensch wie Du und ich. Ich glaube fest daran, dass wir diese schwierige Zeit besser miteinander als gegeneinander überstehen werden. Vielleicht wurde uns das Virus wie die sieben Plagen von einer höheren Macht als Prüfung geschickt.
In Sydney angekommen besichtigten wir zunächst die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten. Danach folgte eine fünftägige Tour durch Zentral-Australien. Wunderschön! Zurück auf dem Schiff gab es noch einige Ausflugsangebote für Sydney und Umgebung. Corona war kein Thema. Dann, einen Tag vor Abreise nach Neuseeland, bekamen wir die Nachricht, dass alle Häfen unserer weiteren Reiseziele – Neuseeland, alle Südseeinseln und die Osterinseln – geschlossen sind.
Der Kapitän Morton Hanssen entschied sich für eine direkte Rückreise nach Bremerhaven. Die Reise sollte etwa vier bis fünf Wochen dauern. Es müsse lediglich noch einmal getankt und Lebensmittel geladen werden. Das sollte im Hafen von Fremantle/Perth stattfinden. Die Reise dorthin dauerte etwa sechs Tage. Unterwegs wurde täglich bei allen Passagieren Fieber gemessen. Erst hatten sechs Personen, dann 37 Personen Fieber und Verdacht auf Corona.
In Fremantle lagen wir zunächst auf Reede. Australien hatte die Anreise verweigert. Das Land war von Corona weitgehend verschont. Die Kranken wurden von Bord in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile konnten wir in den Hafen fahren. Wir befanden uns in Gesellschaft von Frachtschiffen. Andere Kreuzfahrtschiffe waren auf Reede. Nun wurde angeordnet, auf den Kabinen zu bleiben. Das Essen wurde vor die Tür gestellt.
Wir hatten eine Kabine mit großem Balkon, aber viele Passagiere waren in kleinen Kabinen, teilweise mit Bullauge, untergebracht. Nach vielen Verhandlungen wurden wir mit vier Condor-Maschinen nach Frankfurt geflogen. Das war eine Evakuierung. Im Flieger dicht an dicht, Maske während des kompletten Fluges, Essen und Getränke in abgepackten Behältnissen, Zwischenstopp in Phuket zum Tanken, dann weiter nach Frankfurt, insgesamt 24 Stunden. In Frankfurt sollten wir mit Bussen nach Hause gebracht werden.
Das war zu viel für uns. Wir sind mit einem privaten Taxi auf eigene Kosten nach Berlin gefahren. Hier dann 14 Tage Quarantäne. Das Gesundheitsamt kontrollierte täglich per Telefon. Da wir nur mit Handgepäck reisen durften, blieben unsere Koffer an Bord. Sie sollten per Flug nachkommen. Klappte leider nicht. Die Koffer wurden mit der „Artania“ nach Deutschland gebracht und kamen am 9. Juni 2020 am Hafen an. Dann wurden sie zu uns nach Berlin gebracht.
Während der Reise sind drei Menschen an Covid-19 gestorben, 36 Personen waren positiv getestet worden. Wir haben zwei weitere bereits gebuchte Reisen mit Phoenix-Reisen abgesagt. Leider mussten wir die Stornogebühren bezahlen. Unsere Gesundheit ist das wert. Da wir diese Erfahrung gemacht haben, verhalten wir uns extrem vorsichtig. Wir verstehen nicht, wie leichtgläubig manche Menschen mit dem Thema umgehen.
In unserer abgeschieden gelegenen Einsatzstelle haben wir nur wenig von dem Chaos auf der Welt mitbekommen. Trotzdem mussten wir innerhalb von drei Stunden unsere Koffer packen und auf Wiedersehen sagen. Wir hatten gerade alle Hürden überwunden und konnten unseren Aufgaben ohne Komplikationen nachgehen: auf den zum Projekt gehörenden Reisfeldern arbeiten, die Kinder zur Schule begleiten, mit ihnen essen und spielen. Seit Kurzem hatten wir sogar die Kapazitäten, auch größere Projekte zu planen, wie etwa einen Solar-Ofen zu bauen oder einen Workshop zu sexueller Selbstbestimmung zu halten.
Das Wissen über die schrecklichen kinderrechtlichen Umstände auf den Philippinen hat mich sehr geprägt. Jedes einzelne Kind ist mir in der Zeit ans Herz gewachsen. Der Vertrag meines Freiwilligendienstes läuft zum Glück wie geplant bis August, ab jetzt darf ich die Organisation so gut wie möglich von zu Hause aus unterstützen. Dabei ist Kreativität gefragt. Wir hatten die Idee, Arbeitsblätter für die Kinder zu gestalten oder Präsentationen vorzubereiten. Ich sitze also zum Glück nicht nutzlos zu Hause und bin dafür sehr dankbar!
In einer chilenischen Station wurden die Besucher herzlich mit Kaffee und Kuchen empfangen, ohne dass sich ein Coronavirus dazwischendrängte. Entsprechend gedämpft war die Stimmung, als es an die Rückreise – begleitet von etlichen Buckelwalen – ging: Wie sieht es mit den Flügen aus? Was erwartet uns zu Hause? Fast wehmütig ließen wir die letzten antarktischen Gletscher und Bergspitzen zurück. Und tatsächlich: Im Hafen von Ushuaia/Feuerland wurden die Passagiere von der Realität eingeholt: Verlassen des Schiffs nur mit Schutzmaske.
In Buenos Aires gab es dann noch einen Quarantäne-Tag im vom Militär bewachten Hotel, bevor es mit dem letzten regulären Flug via Frankfurt nach Berlin zurückging. Aber wenigstens die Gedanken bleiben frei und gehen immer wieder zurück zu dem Kontinent, in dem es kein Coronavirus, dafür aber umso mehr sorglose Robben, Pinguine und Wale gibt!
FreizeitLesen, Leid und Leidenschaft
Aus lauter Verzweiflung versuchten wir es mit Online-Proben. Das machte weder Spaß noch Sinn, da gemeinsames Singen und sich dabei hören über das Internet nicht möglich ist. Jeder sang für sich allein und hörte nur das Keyboard-Spiel unserer Chorleiterin. Wir leiden sehr darunter, auf den geliebten Chorgesang und die geselligen Stunden innerhalb unserer Gruppe verzichten zu müssen!
So entstand die Idee, dass sich alle 35 Ensemble-Mitglieder des Theaters untereinander Briefe schreiben sollten, damit der Kontakt erhalten bleibt und sich auch einige Menschen aus unserer kreativen Runde nicht so einsam fühlen.
Einer von uns entwarf einen passenden Algorithmus, und wir bekamen die Adressenlisten mit den entsprechenden Anweisungen, wem wir zu schreiben haben, zugeschickt. Zunächst blickte ich etwas fassungslos auf meine Liste, bis auf vier Ausnahmen kannte ich niemanden von den dreizehn Menschen, denen ich bis zum Juli schreiben sollte!
Ich blickte in verschiedene schwarze Löcher, aber dann kam Licht ins Dunkel! Schließlich hatten wir eine gemeinsame Leidenschaft – das Theaterspielen! Außerdem gibt es so viele Fragen zu stellen, wenn man jemanden kennenlernen möchte, der Kugelschreiber huschte nur so über das Papier!
Es ist immer wieder schön, Post zu bekommen, es ist immer wieder spannend! Man bekommt Einblicke in diese Leben, Träume, Schicksale und Gedanken. Da muss doch wirklich so ein blöder Virus daherkommen, um uns zu zeigen, wie schön es ist, wenn man einem anderen Menschen Zeit schenkt.
Zeit, sich hinzusetzen, den Stift zu nehmen und ihm die nächste halbe Stunde einen Einblick in die eigene Welt zu gewähren - diese Verbundenheit und Nachhaltigkeit haben die neuen Medien nicht.
Sie gestaltet auf angenehme Weise einen Teil des Tages. Die Zeit zu strukturieren macht alles etwas erträglicher und somit gehört Zeitunglesen zum festen Bestandteil meines Tagesablaufes. Jetzt, da ich Zeit genug habe, lese ich Seite für Seite, sogar den Sportteil, den ich sonst überschlage.
Auch die längeren Beiträge und Kommentare, die ich früher des Öfteren aus Zeitmangel überflogen habe, zeigen, was mir so alles entgangen ist. Die vielen Denkanstöße, die für eine gewisse Zeit die prekäre Situation, in der wir uns befinden, vergessen lassen. Da verspreche ich in Zukunft Besserung.
Aufmerksamer als sonst lese ich den Lokalteil. Hier erhalte ich Informationen und Ratschläge, die mit den normalen Nachrichtensendungen nicht abgedeckt werden können. Welche Aktionen sind in meiner Umgebung geplant, um Menschen in Not zu helfen? Wie kann ich selbst mein Verhalten verändern, verbessern? Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Probleme bekomme? Gewöhnlich auf der letzten Zeitungsseite wartet ein neuer Höhepunkt auf mich: Sudoku. So kann ich mich noch für eine Weile beschäftigen und freue mich jedes Mal, wenn mir die Lösung schnell gelingt. Gut für Körper und Geist ist im Treppenhaus mein morgendlicher Gang zum Briefkasten und zum Schluss mein Gehirntraining mit Sudoku. Apropos Briefkasten: Zu dem Kreis derjenigen, denen wir dankbar sein sollten, gehören auch die Zeitungszusteller.
Dass der tägliche Flugzeuglärm in seiner unerbittlichen Regelmäßigkeit allerdings so störend und schädlich sein würde, hatten wir uns nicht vorgestellt. Da half auch eine gewisse Gewöhnung nicht. Einziger Trost blieb, dass 2012 in Tegel die staatsvertraglich festgesetzte Ruhe eintreten würde. Wir zählten die Jahre, zuletzt noch die Monate. Und dann – 2012 – die große Enttäuschung: Es geht weiter! Unser mit den Nachbarn vorbereitetes „Tegel-zu!“ -Fest fand trotzdem statt. Seither warten wir Ruheständler in Pankow und können nicht einmal sicher sein, dass wir “Tegel-zu“ überhaupt noch erleben werden.
Dachten wir! Und nun das: Corona! Keiner konnte ahnen, dass ein solcher Winzling von Virus mit seinem unbändigen Vermehrungsdrang die ganze Welt nahezu allen Flugverkehr und alle Tegel-Planungen in Berlin auf den Kopf stellen würde. Die Folge für Pankow: Binnen zwei Wochen ist fast kein Flugzeug mehr über uns am Himmel! Meine Frau ist bei der Ruhe im Liegestuhl auf der Terrasse richtig eingeschlafen! Zum ersten Mal seit wir hier wohnen. Corona kümmert sich weder um brandsichere Hallentüren im BER, noch um dessen automatische Sprinkleranlage, weder um Staatsverträge noch Umweltauflagen. Corona ist einfach da – und das reicht, um verzweifelnden Senioren in Pankow endlich ihren wohlverdienten Ruhestand zu bescheren.
Endlich erschrecken Gartengäste nicht mehr bei jedem Überflug, endlich können wir beim sonntäglichen Nachmittagskaffee auf der Terrasse wieder normale Gespräche führen, ohne alle paar Minuten eine 20-Sekunden-Pause wegen Fluglärms einlegen zu müssen. Endlich ist die Luft (fast) wieder so sauber wie auf Usedom. Allerdings – der Nachbar stellte das bedauernd fest – muss die arbeitende Bevölkerung in unserem Kiez sich Wecker kaufen, denn die morgendlichen 6-Uhr-Maschinen fallen jetzt weg.
KuriositätenLotterleben, Lockdown und Luftnot
Der nahe Stadtgarten lockt in zauberhafte Natur, und nie langweilig wird es mir rund um das Rathaus. Heute badet es in der Sonne. Freundlich und traurig zugleich empfängt mich der über 100 Jahre alte Ziegelbau mit dem stolzen Dreistufen-Turm. Keine Leute auf dem Rathausplatz, kein Kind spielt auf dem trockengelegten modernen Brunnen, kein Besucher strebt dem Verwaltungsgebäude entgegen, kein Gast betritt die Rathausschenke.
Eine Stadt ohne Einwohner, wie ausgestorben; einsam, beängstigend still und unheimlich erscheint sie mir. Am Giebel des Rathauses zieht mich erneut die Gedenktafel in ihren Bann. Ein gelungenes Mahnmal gegen die Hitlerdiktatur, eine fast zu übersehende Reliefplatte aus Bronze. Nicht größer als ein Wahlplakat ist sie an der Außenwand auf Augenhöhe zu betrachten. Das Kunstwerk verschwimmt farblich in den nachgedunkelten Klinkern des Gebäudes, drängt sich nicht in den Vordergrund. „Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg – Zum Gedenken an den Widerstand in Bottrop – 1933–1945“ ist darauf eingemeißelt.
Ich erinnere mich, dass im Februar unser Oberbürgermeister Blumen an der Tafel abgelegt hat, frische weiße Blumen, direkt nach unserer Demonstration, zum Gedenken an die Opfer rechtsradikaler Gewalt in Hanau. Sonne und Schatten beleben in diesem Moment die plastisch dargestellte Mahnung. Totenköpfe und menschliche Gebeine scheinen zu zittern, Hände recken sich Hilfe suchend in die Höhe, ergreifen Seile unter einem dunklen Dach der Gesichtslosigkeit. Symbole für Qual und Sterben lassen mich erschauern.
Ein paar Schritte entfernt auf der Wiese thront die fast 500 Jahre alte Bronzeglocke von St. Cyriakus auf ihrem Betonsockel. „Wat sall nu wo kommen?“, kann man eingraviert in Plattdeutsch lesen. Wie passend, stelle ich für mich fest. Das Mahnen gleitet in die Gegenwart, in eine Zeit, in der zusätzlich etwas Unbekanntes und Todbringendes auch unsere friedfertige Stadt bedroht. Rundum ist kein einziger Passant auszumachen, kein Tourist, der sich interessieren oder ein Gespräch suchen könnte. Mit bedrückenden Gefühlen schleiche ich wie ein streunender Köter zurück in mein Singlezuhause.
Vor dem Bauamtsgebäude begrüßt mich der zufrieden dreinblickende Bergmann als Bronzefigur in Lebensgröße. „Glück auf, alter Kumpel“, grüße ich stumm zurück. Die Autos auf dem Parkplatz scheinen zu schlafen. Unter dem Torbogen begegne ich endlich einem forsch ausschreitenden Mann, der mit Abstand und Maske und einem Kopfnicken an mir vorüberzieht. Ich nicke ebenfalls und lächle unter meinem fröhlich bunten Mund- und Nasenschutz. Vielleicht wird man freundlicher in gemeinsamen Nöten? Über der Gladbecker Straße spannt sich das blass beschriftete Spruchband „Willkommen auf der Gastromeile“. Sonne durchstreift die behagliche Restaurantgasse. Die sonst so belebte Fußgängerzone ist leer gefegt, keine Gäste auf der Außenbestuhlung der Lokale. Auch die stets sauber einladenden Gitterbänke vor den Geschäften sind nicht besetzt. Nicht einmal Hunde gehen Gassi.
Vor meinem Wohnblock auf „meiner Bank“ sitzen zwei männliche Gestalten eng beieinander. Ihr schallendes Lachen ist nicht zu überhören. Hände und Flaschen gestikulieren in der Luft neben zerzausten Haaren. Die Männer schlagen sich gegenseitig auf hagere Schenkel in abgewetzten Hosen. Ihre Welt scheint zu stimmen, ihre Flaschen sind noch halb gefüllt. Wenigstens einer der beiden Kumpanen trägt einen Mundschutz. Beim Näherkommen sehe ich, dass unter seiner Nase keine Maske, sondern ein Tangaslip baumelt. Schmale Bänder führen locker zu seinen Ohren. Das rotschwarze Spitzendreieck bedeckt nur knapp den Mund des fröhlichen Zechers. Er zieht den Stofffetzen kurz unter das Kinn und nimmt einen gehörigen Schluck aus der Flasche. Weite Zahnlücken glänzen, lachen mich ungeniert an. Ohne Scheu gehe ich vorbei und kann das Grinsen unter meiner Maske nicht bremsen. Augenblicklich verdrängt es alle trüben Gedanken.
Waschen kann ich das gute Stück leider nicht, es ist ja täglich im Einsatz und ein anderes Modell nicht zur Hand. Ihre flankierenden goldenen Streifen geben mir dieser Tage etwas Majestätisches, wenn ich zum Kühlschrank schreite. Komme ich fürs Flanieren zum Supermarkt in die Verlegenheit, eine Jeans überzustreifen, muss ich erkennen, dass die Bundweite durch den Lockdown schon fast verloren scheint. Darin offenbart sich die größte Schwäche des sportlichen Beinkleids: Dank ihres elastischen Bundes verzeiht sie viel, vielleicht zu viel.
Die Ursprünge des beliebten Klassikers liegen vermutlich in den 1970ern. Dass das Coronavirus nun imstande ist, die Frisurentrends dieser Jahre gleich mit aufleben zu lassen, ist leider Wasser auf den Mühlen hanebüchener Verschwörungstheorien. Mein goldgestreifter Schatz ist nicht irgendeine Trainingshose: Das Modell „Beckenbauer“ kündet von kaiserlichem Krisenmanagement. Nicht nur, dass die bayrische Sentenz „Dahoam is dahoam“ die Verhältnisse selten so treffend beschrieb; es ist unser Fußballweiser höchstselbst, der es dieser Tage mit den Analysen der öffentlichen Intelligenz locker aufnehmen kann: „Schaun mer mal, dann sehn mer scho”.