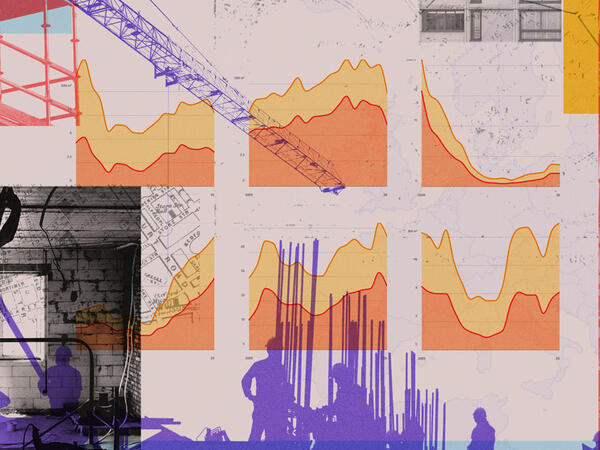35 Jahre nach dem Mauerfall Die Profiteure des Todesstreifens
Wir haben recherchiert, in wessen Hände der Todesstreifen gefallen ist – und wem er heute gehört. Dafür haben wir hunderte Grundstücke innerhalb des S-Bahn-Rings überprüft und mithilfe von Grundbuchauszügen, Archivmaterial und Expertengesprächen ihre heutigen Eigentümer ermittelt.
Die Ergebnisse zeigen wir Ihnen in diesem Artikel mit interaktiven Grafiken, Luftbildern und Karten.
Nach dem Mauerfall bot der Grenzstreifen perfektes Bauland. Große Projektentwickler spekulierten auf Berlins Aufstieg – erfolgreich. Die Mauergrundstücke sind symbolisch für die Entwicklungen auf dem Berliner Grundstücks- und Immobilienmarkt, die zur immer gleichen Schlussfolgerung führt: Geld gewinnt.
Während im Rest der ehemaligen DDR enteignete Grundstücke grundsätzlich den Eigentümern zurückgegeben werden sollten, gingen alle Grundstücke des Todesstreifens an die Bundesrepublik. Die verkaufte sie.
Spät erst versuchte die Stadt, die Erinnerung an die deutsche Teilung nicht ganz verschwinden zu lassen – und ein wiedervereinigtes Berlin mitzugestalten. Gelungen ist das nur begrenzt und oft erst, wenn die Stadtgesellschaft sich für den Erhalt sichtbarer Zeitzeugnisse engagierte.
Heute gehören 32 Prozent der ehemaligen Grenzflächen innerhalb Berlins der Bundesrepublik, darunter jene, auf der das Bundeswirtschaftsministerium steht und die Autobahn A113 im Süden der Stadt verläuft. 35 Prozent besitzt das Land Berlin – hauptsächlich Straßen. 31 Prozent des ehemaligen Mauerstreifens hat der Bund verkauft.

Innerhalb des Rings sind es sogar 45 Prozent. Doch die Bundesanstalt für Immobilienausgaben (Bima) will nicht öffentlich machen, welche tausende Grundstücke in der Hauptstadt verkauft worden sind – und an wen. Sie beruft sich auf den Datenschutz der Käufer.
Im Rahmen des europäischen Rechercheprojekts Ground Control haben wir trotzdem recherchiert, in wessen Hände der Todesstreifen gefallen ist. Und festgestellt: Der einstige Todesstreifen ist heute ein Mahnmal für einen unregulierten und intransparenten Grundstücksmarkt, der die Entstehung von erschwinglichem Wohnraum in Berlins Innenstadt verhinderte.
Blickt man auf die Eigentümer der verkauften Grundstücke innerhalb des S-Bahn-Rings, so deutet sich an: Bezahlbaren Wohnraum gibt es wenig. Heute gehören 45 Prozent der Flächen unterschiedlichen Firmen. Nicht immer sind die Gebäude Wohnhäuser wie etwa der Axel-Springer-Neubau an der Ecke Zimmer- und Axel-Springer-Straße, an der Grenze zwischen den Bezirken Kreuzberg und Mitte.
Fünf Prozent gehören Privatpersonen. 28.975 Quadratmeter, sechs Prozent, sind in den Händen von Genossenschaften. Nur zwei Prozent sind im Besitz landeseigener Wohnungsbaugesellschaften. Und 30 Prozent der Flächen sind nun Eigentumswohnungen, stehen dem Mietmarkt also nicht zur Verfügung.
Der einzige Ort, an dem man heute noch einen Eindruck der massiven Grenzanlagen bekommen kann, ist die Gedenkstätte Bernauer Straße. Direkt entlang der Wohnhäuser verlief die Mauer. Rund 500 Menschen sollen zwischen 1961 und 1989 an der Bernauer Straße geflohen sein, vier Menschen starben bei dem Versuch.
Gleichzeitig steht der Ort symbolisch dafür, wie komplex die Situation um die Mauergrundstücke war.
1996 wurde das „Mauergrundstücksgesetz“ erlassen, das den zum Bau der Grenzanlage enteigneten, früheren Eigentümern die Möglichkeit gab, ihre ehemaligen Grundstücke zu einem Viertel des Verkehrswertes zurückzukaufen.
Doch schon 1990 hatten sich Anwohner der Bernauer Straße dafür eingesetzt, die Grenzanlagen zu erhalten. „Achtung! Achtung! Liebe Mauerspechte, bitte ‚klopfen‘ Sie nicht an diesem Mauerstück. …. Helfen Sie mit, gerade auch den Opfern dieser Grenze eine authentische und würdige Gedenkstätte zu bewahren“, hieß es auf einer Tafel an der Mauer. Der Hauptinitiator der Gedenkstätte, Manfred Fischer, verhinderte den Abriss durch Baufirmen.
Erst 2006 erklärte der Berliner Senat die Bernauer Straße zum zentralen Erinnerungsort an die Teilung Berlins. Da hatte der Bund bereits Grundstücke verkauft, auf denen die Gedenkstätte entstehen sollte. Viele Alteigentümer hatten ihren Bodenbesitz schon zurückgekauft, eigene Pläne und Geschäfte gemacht. Auf einem der Grundstücke stand bereits ein Haus. Der Mauerstreifen war Bauland und wertvoll für Projektentwickler. Dort, wo heute (wieder) originale Grenzanlagen stehen, sollten eigentlich Wohnungen gebaut werden.

Die Flächen, auf denen die Gedenkstätte entstehen sollte, gehörten unterschiedlichsten Eigentümern – Kirchengemeinden, Personen, die ihren Besitz gerade erst zurückgekauft hatten oder Menschen, die im Dritten Reich enteignet worden waren und nun ihre Grundstücke zurückerhalten hatten. Für die Gedenkstätte kaufte das Land Berlin die Grundstücke auf..
Der Wohnungsmarkt war noch nicht überhitzt, Grundstücksspekulation noch kaum Thema. Wenige Jahre später wären die Flächen so teuer gewesen, dass sie mit öffentlichen Geldern für die Gedenkstätte nicht mehr hätten erworben werden können.
Teurer Rückkauf: Die Rolle des Mauerfonds
Das Land Berlin und der Bund finanzierten gemeinsam den zentralen Erinnerungsort, der heute eine Länge von 1,4 Kilometern und Fläche von 4,4 Hektar umfasst. Im Fonds sammelte und verwaltete der Bund das durch den Verkauf von Mauergrundstücken erworbene Geld. Knapp 3,4 Millionen Euro aus diesem Fonds wurden laut Berliner Senatsverwaltung für Finanzen für das Dokumentationszentrum Berliner Mauer verwendet.
Die Einnahmen aus dem Fonds gehen komplett an die ostdeutschen Bundesländer sowie an Berlin. Dort dürfen Sie für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden. Seit Februar 2024 ist der Fonds aufgelöst, das Geld fließt in den Bundeshaushalt, die zweckgebundene Nutzung bleibt aber bestehen.
Der Gedanke dahinter: Die Gewinne, die die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) mit den Verkäufen erzielte, sollten dort landen, wo Menschen von der Grenze betroffen waren.
Als das Mauergrundstücksgesetz 1996 in Kraft trat, war es umstritten. Für viele ehemalige Eigentümer waren die 25 Prozent des Verkehrswertes, den sie für ihr ehemaliges Grundstück zahlen mussten, zu teuer.
Einige entschieden sich, gerichtlich gegen die Regelung vorzugehen. Sie wollten ihre Grundstücke umsonst zurückbekommen, verklagten den Bund – und verloren in letzter Instanz. Namentlich bekannt aus der „Interessengemeinschaft Berliner Mauergrundstücke“ ist in Berlin vor allem Joachim Hildebrandt, der selbst Teil der Bodenpreisspirale wurde, um seinen Besitz zurückzubekommen.
Seine Eltern hatten 1937 ein Grundstück in der Bochéstraße in Alt-Treptow gekauft, um dort ein Wohnhaus zu errichten, was der beginnende Zweite Weltkrieg jedoch verhinderte. 1961, mit dem Bau der Berliner Mauer, wurde das Land zur Sperrzone, die während des Krieges nach Wien emigrierte Familie 1962 enteignet. Nach der Wiedervereinigung bemühte sich Charlotte Hildebrandt gemeinsam mit Sohn Joachim, das Grundstück vom Bund zurückzubekommen.
Nachdem die Interessengemeinschaft vor Gericht verloren hatte, blieb Joachim Hildebrandt nichts anderes übrig, als es dem Bund abzukaufen. Er verhandelte mit mehreren Interessenten, wie er in Interviews berichtete. Letztendlich lieh er sich Geld vom Geschäftsführer des Projektentwicklers Archigon, der auch in der Kreuzberger Dresdner Straße und in der Waldemarstraße auf dem Mauerstreifen baute.
Hildebrandt „erwarb“ also das Grundstück und verkaufte es sogleich an Archigon. Der Projektentwickler sicherte dem vorherigen Eigentümer dafür zu, dass er eine Wohnung in dem Neubau erhält.

Wie viel er bezahlt habe, wisse er nicht mehr genau, sagte Hildebrandt 2020 der „Berliner Zeitung“.
Laut Grundbucheintrag erwarb Joachim Hildebrandt das Grundstück 2014. In den Unterlagen der Bima findet sich ein Eintrag zur parallel zur Bouchéstraße verlaufenden Mengerzeile. Das dortige Grundstück wurde für 385.000 Euro verkauft.
Archigon baute auf dem Grundstück der Familie Hildebrandt 276 Eigentumswohnungen – für Quadratmeterpreise zwischen 3150 und 5000 Euro. Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen lagen zur Zeit der Fertigstellung laut IBB-Wohnungsmarktbericht bei 3000 bis 3500 Euro pro Quadratmeter. Der Bau war von viel Protest aus der Nachbarschaft begleitet, die Mietpreiswucher beklagte.
Südlich des Spittelmarkt in Berlin-Mitte, dort wo der Todesstreifen breiter war als an vielen anderen Stellen, ist ein neues Stadtviertel entstanden: viele schicke Eigentumswohnungen, wenige Geschäfte. Das letzte dortige Projekt wurde 2020 auf 19.000 Quadratmetern Grundfläche fertiggestellt.
Investor ist der an der Börse notierte Projektentwickler Instone. Damals noch unter dem Firmennamen Format kaufte die Firma das Grundstück für 29,1 Millionen Euro von der Bima. In dem Verfahren hatte sich auch die Wohnungsbaugesellschaft Mitte gemeinsam mit einem privaten Investor beworben. Sie bekamen das Grundstück nicht, obwohl der Bund bereits verkündet hatte, Ländern und Kommunen Grundstücke günstiger zum Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen.
Die Bima vergab an den Höchstbietenden. Ähnliches war 2013 mit dem Nachbargrundstück passiert, das der Bund an den Investor Patrizia AG verkauft hatte. Immerhin: 139 Mietwohnungen, die dann die landeseigene Howoge übernahm, entstanden auf dem Grundstück – 25 Prozent, das Berliner Modell sieht 30 vor.

Lange hatte es ausgesehen, als würde der Grenzstreifen hier Brache bleiben. Als erste hatte sich die Concordia Bau und Boden, einer der damals größten Projektentwickler Deutschlands, bereits in den 90er Jahren zehntausende Quadratmeter gesichert – noch bevor die Eigentumsverhältnisse des Grenzstreifens endgültig geklärt waren. Kaufpreis unklar. Gebaut wurde trotzdem nicht.
Kredite bei der Bankgesellschaft Nord zogen die Concordia in den Strudel der Berliner Bankenkrise. Am Ende verspekulierte sich das Unternehmen mit Mietpreisgarantien, die nicht eingehalten werden konnten. Der Grenzstreifen blieb leer.
Doch nach der weltweiten Finanzkrise 2008 hatte auch in Berlin der Bauboom begonnen. Die Bima verkaufte die restlichen Grundstücke. So entstanden über 2000 Wohnungen auf der Fläche zwischen Spittelmarkt und Alexandrinenstraße – mehrheitlich Eigentumswohnungen. Das passierte nicht nur am Spittelmarkt, sondern überall auf dem Mauerstreifen – in Alt-Treptow, in Kreuzberg und in Mitte.
„Was man in Mitte besonders gut beobachten kann, ist, wie sich institutionelle Projektentwickler mit Geldgebern aus dem Finanzmarkt in Berlin durchgesetzt haben“, sagt die Professorin für Stadtplanung Laura Calbet. Sie beschreibt, was am Spittelmarkt passierte, als finanzialisierte Stadtentwicklung. Dabei setzen Projektentwickler auf die steigenden Bodenpreise während der Entwicklungsphase, um diese in Bilanzen als Buchgewinne vermerken zu können. Die Gewinne nutzen sie, um weiteres Kapital zu akkumulieren.
Die Gewinne, die Shareholder: Wer profitiert?
Wie hoch die Gewinne durch Bodenpreissteigerungen sind, zeigt der Bodenrichtwert. Der lag beim Kauf des Mauergrundstückes noch bei 2000 Euro pro Quadratmeter, bei Fertigstellung 2020 dann bei 6000 Euro pro Quadratmeter.
Reingewinne aus dem Projekt betrugen laut Geschäftsbericht 2020 32,9 Millionen Euro. Die fließen an die Shareholder – aktuell ist der größte der Finanzinvestor Activum.
Dabei sollten die Gewinne der Grundstücksverkäufe doch an den Mauerfonds gehen?
Zwischen 2007 und 2022 wurden 43 Millionen Euro in den Fonds eingezahlt. Das Grundstück für 29,1 Millionen Euro in der Stallschreiberstraße ist nicht dabei. Denn eine Ausnahme im Mauergrundstücksgesetz macht es möglich, dass die Einnahmen aus bestimmten Grundstücksverkäufen an den Bund gehen, etwa wenn das Grundstück davor Volkseigentum war.
Kurz gesagt: Gehörte dem Bund ein Grundstück bereits vor dem Mauerbau, bekam er dieses einfach zurück.
Wer von dem Mauerfonds profitierte, ist die East-Side-Gallery. 129.000 Euro flossen in ihre Sanierung. Das 1,3 Kilometer lange Stück der Mauer, auch bekannt als größte Open-Air-Galerie der Welt, lockt jedes Jahr hunderttausende Touristen an. Es ist das längste erhaltene zusammenhängende Mauerstück.
Protesten von Bürger:innen und dem Eingreifen des Bezirks ist es zu verdanken, dass der Ort heute auch als eine Art Gedenkstätte erhalten ist. Alte Pläne der Stadt sahen eine komplette Bebauung des Ufers vor. Zwei Projekte konnten nicht mehr gestoppt werden. Heute stehen dort, nur wenige Meter von den Mauerstücken entfernt, das Hochhaus Living Levels” und das “Pier 61/64”, das erst im vergangenen Jahr fertig gestellt wurde.
Im „Living Levels“ kostet eine 56-Quadratmeter-Eigentumswohnung aktuell 890.000 Euro. Der Investor Maik-Uwe Hinkel hatte beim Baubeginn des Hochhauses 2015 eine „neue Freiheit“ versprochen. Dass an diesem Grenzabschnitt zehn Menschen auf ihrer Flucht aus der DDR starben, blieb unerwähnt.


Hinkel selbst soll für die Stasi spioniert haben, dann für den sowjetischen Geheimdienst KGB, am Ende sogar als Doppelagent für den Bundesnachrichtendienst tätig gewesen sein. Mit seinem Unternehmen CIC Group baute Hinkel nicht nur an der East-Side-Gallery, sondern auch im Prenzlauer Berg oder am Hausvogteiplatz – oft auf ehemaligen öffentlichen Grundstücken.
Ähnlich ist es bei dem Projektentwickler, der hinter „Pier 61/64“ steht: Trockland. Neben dem Pier hat das Unternehmen ein weiteres Apartmenthaus auf dem Todesstreifen gebaut. „Charlie Living“ steht, logischerweise, nahe des Checkpoint Charlie. Andere Grundstücke dort wurden zwangsversteigert. 35 Jahre später gab es hier immer wieder Streit darum, wie die Erinnerung an den Grenzübergang angemessen gewahrt werden soll.
Im „Pier 61/64“ sind alle 75 Wohnungen Mietwohnungen. Auf dem Immobilienportal „Immoscout“ findet man eine Dreizimmerwohnung mit 68 Quadratmetern für 2183 Euro kalt – etwa 32 Euro pro Quadratmeter. Die durchschnittliche Quadratmetermiete in Friedrichshain liegt laut Immoscout bei 15,62 Euro pro Quadratmeter.
Eines der Grundstücke, auf denen das „Pier 61/64“ heute steht, findet sich auf der Liste der Bima. 2007 zahlte der Käufer für 2156 Quadratmeter 343.080 Euro. Für diesen Preis bekommt man heute kaum noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nachbarschaft.
Insgesamt flossen zwischen 2007 und 2022 mehr als 34 Millionen Euro aus dem Verkauf von Berliner Mauergrundstücken in den Mauerfonds. Das sind 80 Prozent der Gesamteinnahmen des Fonds. Dessen Verteilerschlüssel sieht allerdings vor, dass Berlin nur 8,11 Prozent daraus erhält – 3,87 Millionen Euro.
Berliner Grundstücksverkäufe finanzierten so beispielsweise den Erwerb eines Grundstückes am Yachthafen in Mecklenburg-Vorpommern, eine „Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden“ in Sachsen, eine „Sicherung von Archivgut aus der Zeit von 1945 bis 1989“ in Sachsen-Anhalt, „Zuschüsse an Vereine der freiwilligen Straffälligenhilfe“ in Thüringen und eine „Förderung der Gesundheit und Gemeinschaft zur Stärkung des Ehrenamtes im Feuerwehrwesen“ in Brandenburg.
In Berlin selbst reichten die 3,87 Millionen Euro, die das Land seit 2007 bekam, unter anderem für den Bau einer Anlage für südamerikanische Affen im Tierpark Berlin, aber beispielsweise auch für verschiedene Kita-Projekte.
Rund 20 Hektar Fondsvermögen befinden sich laut Bima noch im Besitz des Bundes. Etwa 20 Liegenschaften sind in der mittelfristigen Planung (bis 2026) noch für den Verkauf vorgesehen, diese lägen „überwiegend in Berlin und Brandenburg, vereinzelt noch in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern“. Vielleicht die letzte Chance für bezahlbaren Wohnraum auf dem Mauerstreifen.
Dieser Artikel ist Teil einer langfristigen europäischen Recherche zur Wohnungskrise. Mithilfe von Datenanalysen, Satellitenbildern, Vor-Ort-Reportagen und Experteninterviews versucht die Recherche „Ground Control”, Licht ins Dunkel zu bringen. Besonderer Fokus ist Bauland und der Handel mit Grundstücken. Der europäische Bodenmarkt ist intransparent. Das erschwert es, Unternehmen zu identifizieren, die Land kaufen, um damit zu spekulieren, oder die Politik für verantwortungslose Deals zur Rechenschaft zu ziehen. Und es verhindert eine transparente Debatte darüber, wie wir als Stadt die letzten Freiflächen nutzen können. Deswegen recherchieren Medien in verschiedenen europäischen Hauptstädten gemeinsam urbanen Landbesitz. Eine Übersicht aller internationalen Veröffentlichungen finden Sie auf der Projektwebseite.
Partnermedien und Rechercheorganisationen
Belgien: Apache, Tschechien: Deník Referendum, Frankreich: Mediapart, Polen: Gazeta Wyborcza, Frontstory.pl, Ungarn: Telex, Slowakei: ICJK, Norwegen: iTromsø, Italien: Irpi Media,
Die Recherche wurde von Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) Fonds sowie durch Journalismfund unterstützt. Die Entwicklung der Technologien für das Urban Journalism Network sowie diese Recherche werden durch das Programm Stars4Media unterstützt.
Über die Daten
Die Datenbasis für unsere Analysen stammt aus dem Liegenschaftsplan des Landes Berlin, der jährlich im sogenannten „Fis Broker“, dem Geoportal des Landes Berlin, veröffentlicht wird. Grundlage für die Veröffentlichung ist Paragraph 25 des Berliner Landesvermessungsgesetzes, der vorsieht, dass die Liegenschaften veröffentlicht werden müssen und für jedermann einsehbar sein sollen.
Diesen Datensatz haben wir mit den Angaben zu Flurstücken aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster (ALKIS) sowie dem Datensatz zum Verlauf der Berliner Mauer zusammengeführt. Mithilfe des Datensatzes erhielten wir genaue Angaben zu den Flurstücken, die heute auf dem Mauerstreifen liegen. Mit diesen recherchierten wir die Eigentümer der Grundstücke im Grundbuch.
Alle Datensätze, einschließlich der Grundbuchdaten, entsprechen dem Stand von 2023. Es ist möglich, dass Daten aus dem Grundbuch veraltet sind. Nicht alle öffentlichen Grundstücke lassen sich eindeutig dem Flurstückdatensatz zuordnen. Die Größe der Grundstücke haben wir selbst berechnet. Die Diskrepanz der Datensätze ergibt sich laut Senatsverwaltung aus den unterschiedlichen Aktualisierungszyklen der beiden Datensätze. Der Datenstand des Liegenschaftsplans ist der 28. Februar 2023, der der Flurstückkarte aus ALKIS der 1. September 2023.
Weil wir mehrere Geodatensätze automatisch miteinander verrechnet haben, ist es möglich, dass Ungenauigkeiten entstanden sind. So kann es etwa sein, dass ein einzelnes Grundstück in unserer Karte als mehrere Grundstücke dargestellt wird oder einem Grundstück mehrere öffentliche Eigentümer zugeordnet werden. Auch das liegt daran, dass die Datensätze der Senatsverwaltung nicht eindeutig einander zuzuordnen sind. Wir haben alle Grundstücke über 1000 m² manuell überprüft. Sollten Ihnen weitere Ungenauigkeiten auffallen, so wenden Sie sich gerne an die oben genannte E-Mail-Adresse.