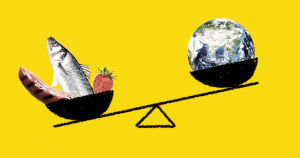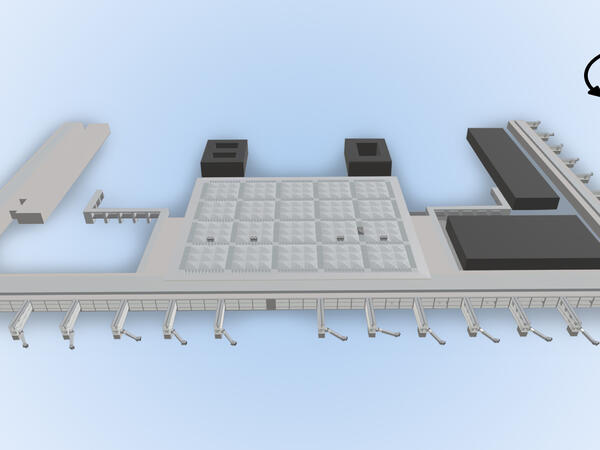Dieser Mann holt Afrika nach Reinickendorf
John Cole packt Yamswurzeln in Plastiktüten, wiegt ab, tippt Preise ein. Gleichzeitig telefoniert er mit einem Großmarkt in den Niederlanden, das weiße Smartphone zwischen Schulter und Kopf geklemmt. „One aloe vera“, sagt er, „brown coconut two.“ Ob der Händler auch Kochbananenchips habe? „Give me 15 boxes.” Mit den Augen scannt Cole, ein großer, imposanter Mann mit strahlendem Lächeln, das Sortiment seines kleinen Ladens in Berlin-Reinickendorf, schaut, was fehlt. Noch Chili aus Uganda, thank you.
Es ist ein grauer Montag, durch die offene Tür lärmt die Ollenhauer Straße. Der Geruch von Gewürzen und Fisch dringt selbst durch FFP2-Masken. Perücken und Haarteile hängen neben getrockneten Babyshrimps, im Regal stapeln sich Kisten mit süßen Mangos und sogenannten „Garden Eggs“, gelben Mini-Auberginen.
Seit zehn Jahren verkauft John Cole Lebensmittel und Kosmetik in seinem Exo-markt Afro Shop. Er trägt eine graue Pulloverjacke, eine grüne Cap und klobige beige Sneaker, ist 50, wirkt aber mindestens zehn Jahre jünger. Cole ist nicht nur Ladenbesitzer, sondern auch Ein-Mann-Logistikunternehmen. Seit 6 Uhr ist er auf den Beinen, war im Großmarkt und bei der Bank. Am Abend noch wird er in seinen Sprinter steigen und nach Brüssel zum Flughafen fahren.
Erst in den Morgenstunden wird er sich kurz schlafen legen und dann seine Ware holen, die mit dem Flugzeug aus Afrika importiert wurde. Am Flughafen wird er andere Ladenbesitzer und Händler aus Holland und Belgien treffen und Lebensmittel an sie verteilen, dann weiter nach Berlin fahren, mit Stopps in Essen, Oberhausen, Dortmund, Bielefeld und Hamburg, wo er weitere Läden beliefert. Mittwochmittag wird er wieder in Berlin ankommen und sich hinter die Kasse stellen. „Ich mache das jede Woche“, sagt John Cole und lächelt. „Das ist schon anstrengend.“

Aber die Mühe lohnt sich. Seit Cole, der aus Gambia stammt, auch frische Lebensmittel aus Afrika importiert, brummt das Geschäft. In seinen Shop kommt die afrikanische Community aus der Gegend. Die ist zwar verhältnismäßig klein, wächst aber stetig. 67.583 Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund zählte das Landesamt für Statistik in Berlin im Juni 2021, fast 20.000 mehr als noch 2015. 36.611 davon sind sogenannte „Ausländer“, also Menschen ohne deutschen Pass. Afrikanische machen zwar nur 4,7 Prozent aller „Ausländer“ in Berlin aus, aber in jedem Bezirk ist die Anzahl der Menschen mit afrikanischen Vorfahren oder afrikanischem Pass zuletzt gestiegen.
Am größten ist die Community in Mitte, hier leben 11.252 Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund. In Reinickendorf im Norden der Stadt, wo John Cole seinen Laden hat, stieg die Zahl von 4.683 auf 6.475. In vielen Ostbezirken haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt. Das macht sich auch bei Cole bemerkbar: Zweimal die Woche liefert er Ware an Privatkunden, denen der Weg zu seinem Laden zu weit ist. Nach Lichtenberg, Hellersdorf, Marzahn, Ahrensfelde. Viele seien in den Osten gezogen, weil dort die Mieten noch günstiger seien – die Wohnungsnot sei ein riesiges Thema unter Afrikanern in Berlin.
John Cole weiß das, weil sein Laden auch ein Treffpunkt der Community ist. Frauen mit bunten Tüchern im Haar unterhalten sich, während sie die Beschriftung von Erdnussbuttergläsern studieren und Mangos betasten. Ein kleines Kind in dicker Jacke schreit, während die Mutter Smalltalk macht. Es hat Orangenlimo entdeckt. Seine Mutter lässt sich davon nicht beeindrucken, sie scannt das Kosmetikregal.

Mit seinen Kunden spricht Cole auf Deutsch, Englisch und Französisch, erkundigt sich nach Verwandten. „Na, junger Mann?“, „How are you, sister?”, „Bonjour Monsieur, ça va?“ Französisch hat er sich selbst beigebracht, um mit seinen Kunden aus den frankophonen Teilen Westafrikas sprechen zu können. Seine Kundschaft bestehe aus etwa 80 Prozent aus Afrikanern, aber zuletzt kämen immer mehr europäische Besucher. Dann verwandelt sich John Cole vom Versorger zum Botschafter seiner Community, berät die europäischen Kunden, wie man die Lebensmittel am besten zubereitet. Da hilft es, dass er selbst leidenschaftlich gern kocht. „Mehr als meine Frau,“ sagt er und lacht – wie so oft.
Schon mit 13 habe er für seine ganze Familie gekocht, erzählt er. Die gehöre den Aku an, auch Krio genannt. Das ist ein ursprünglich aus Sierra Leone stammendes Volk, das etwa durch Ehen auch europäische Wurzeln hat. Westliche Kultur war Teil seines Familienlebens, Bildung für alle Kinder sei wichtig gewesen. Außerdem mussten alle im Haushalt mit anpacken, nicht nur die Frauen. „Bei uns kochen Papa und Mama“, sagt Cole. Er kocht besonders gern Cheb, die senegambische Version des berühmten Jollof-Reises, außerdem Okra- oder Erdnusssuppe.
Hier könnt ihr direkt einen Blick in den Exo-Markt werfen und mehr über afrikanisches Essen in Berlin lernen:
Mittlerweile bereitet er diese Gerichte nicht nur zu, sondern verkauft die Zutaten für sie an die Bewohner der Stadt. In der Tiefkühltruhe findet sich Fufu, ein Brei aus Maniok und Kochbananen, der besonders in Ghana und im Kongo viel gegessen wird, außerdem gesalzene Schweinefüße, ein typisch ghanaisches Gericht. Am beliebtesten aber sind die großen gelben Kochbananen, die man am besten in der Pfanne in Öl frittiert, am Ende etwas Salz drauf. Palmöl darf natürlich nicht fehlen. Fast jede Nation hat sein eigenes. In mehreren Regalen reihen sich zahlreiche orange Flaschen aneinander. Viele würden nur das Palmöl aus ihrem eigenen Land essen, erzählt John Cole, während er sich in der kleinen Küche einen Jasmintee braut – gut zum Abnehmen sei der.
Zur Mittagszeit wird es voll im Geschäft. Ein kleines Kind mit Glasperlen im Haar greift sich Kochbananenchips und platziert sie im Einkaufskorb seiner Mutter. Eine Frau mit Afro fragt nach Makayabu, getrocknetem Salzfisch aus dem Kongo. Natürlich hat John Cole ihn vorrätig. Er geht zum Tiefkühlregal, packt ihn aus. „Schön, oder?“ Ob die Chilis scharf seien, will ein anderer Kunde wissen. Cole ist sich nicht sicher, da die Ware heute erst eingetroffen ist. „Aber die sehen scharf aus.“




Als er 2009 nach Reinickendorf zog, wohnten bereits viele Afrikaner in der Gegend, aber Shops habe es nur im benachbarten Wedding gegeben. Da kam ihm die Idee für den Laden. „Viele haben gesagt, das sei zu weit weg hier“, sagt Cole. „Ich habe dann eine Studie gemacht.“ Er beobachtete, wer aus dem Kaufland gegenüber herauskam.
Seine Recherche überzeugte ihn davon, seinen Laden zu eröffnen. Er hörte sich an, was seinen Kunden fehlte, importierte aus Kamerun, dem Kongo, aus Gambia, Senegal, Burkina Faso und Togo. „Die Kongolesen mussten damals nach Belgien oder Frankreich fahren, um bestimmte Produkte zu bekommen“, sagt Cole. „Ich bringe alles direkt nach Berlin.“ Förderlich für das Klima ist das natürlich nicht. Des Problems sei er sich bewusst, sagt er, aber er habe momentan keine Lösung dafür, wie er die frischen Lebensmittel anders als per Flugzeug nach Deutschland bekommen könnte.
Wo ihr neben dem Exo-Markt weitere Afro-Shops und afrikanische Restaurants in Berlin findet, zeigt euch diese Karte:
John Cole liefert den Menschen ein kleines Stück ihrer Heimat. Seine eigene vermisst er manchmal. Gerne würde er mal wieder nach Gambia reisen, seine Familie und Freunde dort sehen. Die vergangenen fünf Jahre war er nicht mehr da. Ohnehin könnte er nur für eine Woche verreisen, höchstens zehn Tage. „Wegen der ganzen Verantwortung hier.“
Im Januar 2001 kam Cole nach Berlin. Neun Monate lernte er an einer Sprachschule Deutsch, gleichzeitig arbeitete er in der Gastronomie. Selbstständig tätig war er auch in Gambia, dort hatte er ein Transportunternehmen. „Das waren sehr schöne Zeiten“, sagt Cole. Er habe damals gutes Geld verdient, trotzdem trieb es ihn in die Ferne. „Man denkt, alles ist in Europa.“

Cole war mal Restaurantbesitzer, einer seiner zahlreichen Jobs. Momentan ist er wieder auf der Suche nach Räumlichkeiten in Reinickendorf, um ein pan-afrikanisches Restaurant zu eröffnen. Mit all seiner Erfahrung ist er sicher, dass sein Konzept aufgehen wird. Die besten Sachen aus jedem Land, jeden Sonntag ein afrikanisches Buffet. Mit frisch importieren Zutaten, versteht sich. Und alles angepasst an den deutschen Geschmack.
„In viele afrikanische Restaurants trauen sich Europäer nicht rein.“ Da sei es oft sehr laut, das Essen schmecke intensiv. „Man muss das modernisieren“, sagt der Geschäftsmann. Fragen von Authentizität plagen John Cole wenig: „Wenn die Kundschaft nur aus Afrikanern besteht, wie machst du dann Geld?“ Und die Chinesen hätten das schließlich auch gemacht mit ihrem Essen – es angepasst an den Geschmack ihrer größten Kundengruppe: die Menschen ohne Einwanderungsgeschichte.